Noch sind die meisten motiviert
Seit es Spitäler gibt, ringen Pflege, Ärzte und Verwaltung um die Vorherrschaft – zum Vorteil der Patienten. Jetzt hat das Management gewonnen.
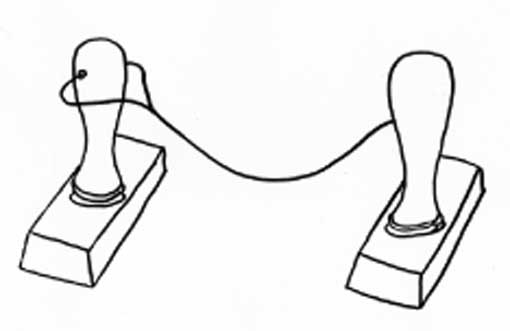
Aus Patientensicht ist klar: Ärzte sollen sich um sie kümmern, soviel es geht. Das ist die Erwartung. Real wenden Schweizer Spitalärzte durchschnittlich 34 Prozent ihrer täglichen Arbeitszeit für patientennahe Tätigkeiten auf. Rund ein Drittel der täglichen Arbeit widmet sich direkt den Patienten, der Rest anderen Aufgaben, z.B. administrativen. Zudem sank dieser Zeitanteil in den letzten beiden Jahren um vier Prozent. Dieselbe Studie, aus welcher diese Daten stammen – es handelt sich um die aktuelle Begleitforschung zur Einführung von Fallpauschalen in Spitälern –, weist zudem aus, dass 80 Prozent der Ärzte zufrieden sind mit ihrem Beruf. Nur ein Drittel der Zeit wendet sich direkt an die Patienten und der überwiegende Prozentsatz der Mediziner ist zufrieden – passt das zusammen? Diese kleine Paradoxie ist ein guter Einstieg in die Komplexität der heutigen Spitalverhältnisse.
Seit 150 Jahren
Klagen von Ärzten über zunehmende Administrierung sind Legion. Immer wieder hört man Aussagen wie: «Ich habe diesen Beruf doch nicht gewählt, um Verwaltung zu betreiben.» Niemand mag bestreiten, dass der Anteil an Leistungserfassungen, Rechtfertigungen, Ausfüllen von Anträgen, Listen und Statistiken aller Art im letzten Jahrzehnt stark zugenommen hat. Besagte Studie spricht von durchschnittlich 20 Minuten Zunahme in den letzten beiden Jahren. Wobei nicht zu vergessen ist, dass die klassische Spitaltätigkeit immer schon aus mehr bestand, als Patienten zu behandeln. Und der Patient war immer schon vieles: einerseits Kranker, zu kurierende Person, gleichzeitig aber auch Träger einer Fallpauschale, Erlösbringer ebenso wie Kostenverursacher, Studienobjekt, Forschungs- und nicht zuletzt auch Lehrgegenstand. Kurz, die Verhältnisse waren immer schon kompliziert. A propos kompliziert: Bereits 1863 hatte Florence Nightingale, die Mutter der modernen Spitalpflege, in ihren «Notes on Hospitals» angemerkt, dass Spitäler vom Ringen zwischen Pflege, Ärzten und Verwaltung gekennzeichnet wären. Und dass dieses Ringen gut sei – für die Patienten. Würde die Pflege alleine bestimmen, stünden Soziales und Spirituelles zu sehr im Vordergrund, die Ärzte alleine würden zu viele Eingriffe machen und die Verwaltung würde allzu sehr auf Effizienz achten. Erst durch die Auseinandersetzung der drei Gruppen entsteht etwas Gutes – für die Patienten.
Eine weise Einsicht. Heute ist das nicht viel anders, immer noch ringen diese (und noch andere) Gruppen um Lösungen und Einfluss. Etwas zugespitzt können wir sagen, dass in den letzten zehn Jahren die «Administration», heute Management genannt, obenauf geschwungen ist. War es früher die Pflege, dann die Ärzte, beansprucht heute das Management einen Spitzenplatz. Womit sich die Frage stellt, welche Wirkungen und Nebenwirkungen das aktuelle Ringen hervorbringt. Es gibt ja keinen bösen Geist oder eine spezielle Hinterlist des Managements, die es dazu anhalten würde, Mediziner mit administrativen Aufgaben zu quälen. Auch ist nicht davon auszugehen, dass Unmenschen am Werk wären. Im Gegenteil, anzunehmen ist, dass auch das Management seinerseits nach Professionalität trachtet. Und da wird es interessant: Alle versuchen ihr Bestes und heraus kommt Suboptimales. Wie das?
Das Problem ...
Noch in den 1970er-Jahren reichten 2,5 Stellen an klinischem Personal, um einen durchschnittlichen Patienten im Spital behandeln zu können. Kaum 20 Jahre später brauchte es bereits 15. Ein amerikanischer Chirurg zählte 2012 bei der Knieoperation seiner Mutter zu seiner eigenen Verblüffung 63 Beteiligte, vom Radiologen über den Operateur bis hin zu Pflegenden und Physiotherapeuten. Diese Steigerung ist höchst eindrücklich und führt eines der zentralen Probleme im heutigen Gesundheitswesen vor Augen: Die fortlaufende Koordination und Kooperation auf hohem Niveau für eine Vielzahl von Beteiligten zuwege zu bringen.
Diese Problematik geht einher mit intensivierten betriebswirtschaftlichen und administrativen Ansprüchen. Wie man sich rasch vorstellen kann, ist bei 63 Beteiligten nur schon die Leistungserfassung viel aufwändiger. Wichtig ist nun, dass der erhöhte Abstimmungsbedarf mit den traditionellen Spitalstrukturen nicht beantwortet werden kann, sondern neue Formen des Organisierens zu (er-)finden sind. Und hier kommt das Management ins Spiel. Was es vielfach antrifft, ist unzureichende Koordination, Doppelspuriges, Unabgestimmtes, Territorialkämpfe statt Kooperation, Schlankes und Gemeinsames. Kurz, es tut sich eine Organisierungslücke auf, die zu füllen ist. Das Management versucht naturgemäss diese Lücke ausgehend von seinen eigenen Konzepten zu schliessen, und das nimmt oftmals die Form von Regelungen, Standardisierungen und Zentralisierungen an. Die gute Absicht wäre, Klarheit in unübersichtliche Verhältnisse zu bringen. Die Wirkung kann oftmals eine andere sein. Nach bestem Wissen und Gewissen werden Strukturen entwickelt, Pläne konzipiert, Rapportsysteme eingeführt und Leistungserfassungen organisiert – die meisten davon nehmen Zeit der medizinisch Tätigen in Anspruch, vieles davon wird als administrativer Mehraufwand empfunden.
... der Ungewissheit
Die Frage, ob ein Kind mit angeborenem Herzfehler einer neuerlichen, schweren Operation mit ungewissem Ausgang unterzogen werden soll, bedeutet eine enorm schwierige Entscheidung für alle Beteiligten; für die Angehörigen, wie für Ärzte und Pflegende. Die Folgen der Entscheidung sind weitreichend: für das Kind, für seine Familie, für die betreuenden Mediziner, die Pflegenden (und am Ende auch für die Betriebswirtschaft des Spitals). Die Ungewissheiten sind massiv. Wird das Kind genesen, welche Lebensqualität wird es haben, wird seine Familie mit der Situation umgehen können, welche Prognosen sind möglich, welche medizinischen Empfehlungen lassen sich geben, wie wird die Operation verlaufen, wie lange wird es im Spital bleiben müssen? Die Liste liesse sich fast beliebig verlängern.
Das Kernproblem der Medizin bleibt die Bewältigung der Ungewissheit, die in den Prozessen der Diagnose und Therapie kranker Menschen steckt. Diese Ungewissheit zu bewältigen, gelingt nur zu einem beschränkten Teil durch administrierendes Handeln. Das ist aber die naheliegende Idee, wenn man einem klassischen, eher technisch gehaltenen Managementverständnis folgt. Dann aber beginnen sich die verschiedenen Welten in die Quere zu kommen. Halten wir fest: (Über-)Administrierung ist Resultat von Lücken, die sich in der Entwicklung moderner Spitalstrukturen und Versorgungsprozessen ergeben. Die Vorstellungen, wie diese Lücken zu schliessen sind, bleiben oftmals disparat.
Motivationen
Bislang operiert unser Gesundheitssystem unter Inanspruchnahme hoher Motivationsgrade. 80 Prozent der Ärzte und Ärztinnen sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Beruf. Hinter dieser Zahl verbirgt sich eine gewaltige Ressource an Motivation. Die 80 Prozent – in welchem anderen Beruf ist das zu finden? – sind zugleich ein sehr erfreulicher wie warnender Wert. Das Erfreuliche daran ist, dass Patienten davon ausgehen dürfen, mit Menschen zu tun zu haben, die an dem interessiert sind, was sie tun. Des Weiteren hilft diese Motivationslage, Ungereimtheiten des Systems durch persönlichen Einsatz wett zu machen. Paradoxerweise führt Letzteres dazu, dass personale Kompensationen auch dort geleistet werden, wo eigentlich bessere organisationale Lösungen zu suchen wären. Es wird Raubbau an den Motivationsressourcen betrieben. Die Warnung besteht darin, nicht zu warten, bis diese aufgebraucht sind. Bereits sehen wir, dass die jungen Ärzte deutlich unzufriedener sind – Ungemach ist im Anzug.
Dr. Christof Schmitz ist geschäftsführender Gesellschafter des college M, Bern und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Frage der Integration von Management und Medizin vor dem Hintergrund der Veränderungen im Gesundheitswesen. www.college-m.ch

Mehr zum Thema Bürokratie im Schwerpunktheft «Formularkrieg»
Christof Schmitz spricht an der Tagung «Zur Sache – die Fesseln der Bürokratie sprengen» vom 25. Oktober 2014 in Zürich
Seit 150 Jahren
Klagen von Ärzten über zunehmende Administrierung sind Legion. Immer wieder hört man Aussagen wie: «Ich habe diesen Beruf doch nicht gewählt, um Verwaltung zu betreiben.» Niemand mag bestreiten, dass der Anteil an Leistungserfassungen, Rechtfertigungen, Ausfüllen von Anträgen, Listen und Statistiken aller Art im letzten Jahrzehnt stark zugenommen hat. Besagte Studie spricht von durchschnittlich 20 Minuten Zunahme in den letzten beiden Jahren. Wobei nicht zu vergessen ist, dass die klassische Spitaltätigkeit immer schon aus mehr bestand, als Patienten zu behandeln. Und der Patient war immer schon vieles: einerseits Kranker, zu kurierende Person, gleichzeitig aber auch Träger einer Fallpauschale, Erlösbringer ebenso wie Kostenverursacher, Studienobjekt, Forschungs- und nicht zuletzt auch Lehrgegenstand. Kurz, die Verhältnisse waren immer schon kompliziert. A propos kompliziert: Bereits 1863 hatte Florence Nightingale, die Mutter der modernen Spitalpflege, in ihren «Notes on Hospitals» angemerkt, dass Spitäler vom Ringen zwischen Pflege, Ärzten und Verwaltung gekennzeichnet wären. Und dass dieses Ringen gut sei – für die Patienten. Würde die Pflege alleine bestimmen, stünden Soziales und Spirituelles zu sehr im Vordergrund, die Ärzte alleine würden zu viele Eingriffe machen und die Verwaltung würde allzu sehr auf Effizienz achten. Erst durch die Auseinandersetzung der drei Gruppen entsteht etwas Gutes – für die Patienten.
Eine weise Einsicht. Heute ist das nicht viel anders, immer noch ringen diese (und noch andere) Gruppen um Lösungen und Einfluss. Etwas zugespitzt können wir sagen, dass in den letzten zehn Jahren die «Administration», heute Management genannt, obenauf geschwungen ist. War es früher die Pflege, dann die Ärzte, beansprucht heute das Management einen Spitzenplatz. Womit sich die Frage stellt, welche Wirkungen und Nebenwirkungen das aktuelle Ringen hervorbringt. Es gibt ja keinen bösen Geist oder eine spezielle Hinterlist des Managements, die es dazu anhalten würde, Mediziner mit administrativen Aufgaben zu quälen. Auch ist nicht davon auszugehen, dass Unmenschen am Werk wären. Im Gegenteil, anzunehmen ist, dass auch das Management seinerseits nach Professionalität trachtet. Und da wird es interessant: Alle versuchen ihr Bestes und heraus kommt Suboptimales. Wie das?
Das Problem ...
Noch in den 1970er-Jahren reichten 2,5 Stellen an klinischem Personal, um einen durchschnittlichen Patienten im Spital behandeln zu können. Kaum 20 Jahre später brauchte es bereits 15. Ein amerikanischer Chirurg zählte 2012 bei der Knieoperation seiner Mutter zu seiner eigenen Verblüffung 63 Beteiligte, vom Radiologen über den Operateur bis hin zu Pflegenden und Physiotherapeuten. Diese Steigerung ist höchst eindrücklich und führt eines der zentralen Probleme im heutigen Gesundheitswesen vor Augen: Die fortlaufende Koordination und Kooperation auf hohem Niveau für eine Vielzahl von Beteiligten zuwege zu bringen.
Diese Problematik geht einher mit intensivierten betriebswirtschaftlichen und administrativen Ansprüchen. Wie man sich rasch vorstellen kann, ist bei 63 Beteiligten nur schon die Leistungserfassung viel aufwändiger. Wichtig ist nun, dass der erhöhte Abstimmungsbedarf mit den traditionellen Spitalstrukturen nicht beantwortet werden kann, sondern neue Formen des Organisierens zu (er-)finden sind. Und hier kommt das Management ins Spiel. Was es vielfach antrifft, ist unzureichende Koordination, Doppelspuriges, Unabgestimmtes, Territorialkämpfe statt Kooperation, Schlankes und Gemeinsames. Kurz, es tut sich eine Organisierungslücke auf, die zu füllen ist. Das Management versucht naturgemäss diese Lücke ausgehend von seinen eigenen Konzepten zu schliessen, und das nimmt oftmals die Form von Regelungen, Standardisierungen und Zentralisierungen an. Die gute Absicht wäre, Klarheit in unübersichtliche Verhältnisse zu bringen. Die Wirkung kann oftmals eine andere sein. Nach bestem Wissen und Gewissen werden Strukturen entwickelt, Pläne konzipiert, Rapportsysteme eingeführt und Leistungserfassungen organisiert – die meisten davon nehmen Zeit der medizinisch Tätigen in Anspruch, vieles davon wird als administrativer Mehraufwand empfunden.
... der Ungewissheit
Die Frage, ob ein Kind mit angeborenem Herzfehler einer neuerlichen, schweren Operation mit ungewissem Ausgang unterzogen werden soll, bedeutet eine enorm schwierige Entscheidung für alle Beteiligten; für die Angehörigen, wie für Ärzte und Pflegende. Die Folgen der Entscheidung sind weitreichend: für das Kind, für seine Familie, für die betreuenden Mediziner, die Pflegenden (und am Ende auch für die Betriebswirtschaft des Spitals). Die Ungewissheiten sind massiv. Wird das Kind genesen, welche Lebensqualität wird es haben, wird seine Familie mit der Situation umgehen können, welche Prognosen sind möglich, welche medizinischen Empfehlungen lassen sich geben, wie wird die Operation verlaufen, wie lange wird es im Spital bleiben müssen? Die Liste liesse sich fast beliebig verlängern.
Das Kernproblem der Medizin bleibt die Bewältigung der Ungewissheit, die in den Prozessen der Diagnose und Therapie kranker Menschen steckt. Diese Ungewissheit zu bewältigen, gelingt nur zu einem beschränkten Teil durch administrierendes Handeln. Das ist aber die naheliegende Idee, wenn man einem klassischen, eher technisch gehaltenen Managementverständnis folgt. Dann aber beginnen sich die verschiedenen Welten in die Quere zu kommen. Halten wir fest: (Über-)Administrierung ist Resultat von Lücken, die sich in der Entwicklung moderner Spitalstrukturen und Versorgungsprozessen ergeben. Die Vorstellungen, wie diese Lücken zu schliessen sind, bleiben oftmals disparat.
Motivationen
Bislang operiert unser Gesundheitssystem unter Inanspruchnahme hoher Motivationsgrade. 80 Prozent der Ärzte und Ärztinnen sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Beruf. Hinter dieser Zahl verbirgt sich eine gewaltige Ressource an Motivation. Die 80 Prozent – in welchem anderen Beruf ist das zu finden? – sind zugleich ein sehr erfreulicher wie warnender Wert. Das Erfreuliche daran ist, dass Patienten davon ausgehen dürfen, mit Menschen zu tun zu haben, die an dem interessiert sind, was sie tun. Des Weiteren hilft diese Motivationslage, Ungereimtheiten des Systems durch persönlichen Einsatz wett zu machen. Paradoxerweise führt Letzteres dazu, dass personale Kompensationen auch dort geleistet werden, wo eigentlich bessere organisationale Lösungen zu suchen wären. Es wird Raubbau an den Motivationsressourcen betrieben. Die Warnung besteht darin, nicht zu warten, bis diese aufgebraucht sind. Bereits sehen wir, dass die jungen Ärzte deutlich unzufriedener sind – Ungemach ist im Anzug.
Dr. Christof Schmitz ist geschäftsführender Gesellschafter des college M, Bern und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Frage der Integration von Management und Medizin vor dem Hintergrund der Veränderungen im Gesundheitswesen. www.college-m.ch

Mehr zum Thema Bürokratie im Schwerpunktheft «Formularkrieg»
Christof Schmitz spricht an der Tagung «Zur Sache – die Fesseln der Bürokratie sprengen» vom 25. Oktober 2014 in Zürich
31. August 2014
von:
von:
- Anmelden oder Registieren um Kommentare verfassen zu können


