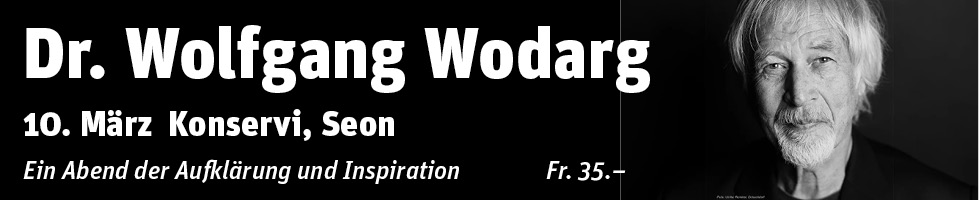Abfahrt im Jahr 1516. Es ist das Zeitalter der Entdeckungen, überall tauchen neue Küsten auf. Amerika, Afrika, Asien: Die Horizonte fliegen dahin. Neue Welten, neue Inseln, wilde Stämme und exotische Kulturen. Kolumbus, Cook und viele weitere suchen, finden und berichten. Und Europas Leserinnen und Leser verschlingen ihre Geschichten. Dann publiziert ein gewisser Thomas More einen weiteren Text. Er führt darin einen Dialog mit einem Mann, der mehrere Jahre auf einer Insel mit dem Namen «Utopia» verbracht haben will. Es ist ein Bericht wie viele – und anders als alle andern. Schon die Namensgebung ist doppelbödig: Utopia heisst Nicht-Ort. In englischen Ohren klingt es aber zugleich wie Eutopia: der glückliche Ort.
Auf der Insel, so wird berichtet, leben die Menschen in Verbänden von je dreissig Familien. Es gibt keinen privaten Besitz und die Gesellschaft ist klosterähnlich und hierarchisch organisiert. Gold interessiert die Utopier nicht, stattdessen hält sich jede Familie zwei Sklaven. Es gibt eine Schulpflicht, eine Arbeitspflicht, öffentliche Gesundheitsversorgung, Euthanasie und viele verschiedene Religionen, die einander tolerieren. Nur Atheisten werden schlecht behandelt. Wissenschaft und Kunst sind der Utopier liebste Hobbys. Ausserdem ist Utopia eine Welt ohne Anwälte.
Ist Utopia eine Gesellschaftskritik oder eine Satire? Es gibt Beweise für beides. More unterstützt manche Ideen der Utopier, andere laufen seinen eigenen fundamental zuwider. Ausserdem nennt er seinen Gesprächspartner «Hythlodaeus» (Possenreisser) und sich selber «Morus» (Narr). Es ist diese schillernde Vieldeutigkeit, die das Buch so unfassbar macht, dass es über Jahrhunderte hinweg immer wieder besprochen und neu interpretiert wird. «Utopia» wird zum eigentlichen Ur-Buch eines literarischen Genres.
Nach Utopia erscheinen alle möglichen Gesellschaftsentwürfe. Die meisten berichten von weit entfernten Inseln und skizzieren Gesellschaften, die einfacher, reiner und meistens auch klarer organisiert sind. Sie stehen für die Sehnsüchte nach einer besseren Welt – oder dem, was die Autoren dafür halten.
Im 19. Jahrhundert gibt es eine Wende in der utopischen Literatur. Die Landkarten sind beinahe vollständig; neue Küsten tauchen nicht mehr auf. Es wird immer deutlicher: Das war’s jetzt, mehr gibt es auf dieser Welt nicht zu entdecken. Zugleich aber verändert sich das Leben immer schneller. Nebst Sozialutopien tauchen Technikutopien auf, und statt in der Südsee liegt Utopia nun in der Zukunft. H.G. Wells und Jules Verne sind die Vordenker einer neuen Zeit und entwickeln mit «War of the Worlds» und «Le Voyage dans la Lune» Welten, die übermorgen schon Realität sein könnten. Sie interessieren sich weniger für ideale Gesellschaften als für die Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Die utopische Literatur mutiert zur «Science Fiction».
Diese erlebt immer dann einen Boom, wenn der Fortschritt besonders spürbar wird. So hinterliessen das Apollo-Programm und die Mondlandung deutliche Spuren in Literatur und Film. Die neuen Visionen aber sind nicht von Euphorie geprägt, sondern von Kritik. In «Star Wars» ist die Technik auf der Seite der Bösen, die Guten fliegen in klapprigen Raumschiffen und vertrauen auf eine spirituelle «Macht». In «Space Odyssey» wendet sich der Computer gegen die Menschen. Und bei «Star Trek» reist die Besatzung durch die Zeit zurück, um auf der Erde die Wale zu retten. Gerade das letzte Beispiel illustriert: Eigentlich handeln Utopien gar nicht von einer anderen Welt – sondern vom Hier und Jetzt.
Utopien entwickeln bildgewaltige Geschichten mit suggestiver Kraft. Aus Konjunktiven beschwören sie Wirklichkeiten herauf. «Imagine», sang John Lennon. Und heute? Welche Vision darf es sein? Grüne Natursehnsucht oder religiöser Fanatismus? Die Klimakatastrophe oder die Rettung durch den Fortschritt? Beschränkung aufs Nötigste oder hedonistische Konsumwut? Esoterischer Spritismus oder scientistischer Materialismus?
Utopien sind Seismographen unserer Sehnsüchte und Ängste. Und sie spiegeln unsere Sehnsucht nach dem Ende der Geschichte. Denn die Entwürfe – von More über Marx bis Musk – haben einen Hang zum Statischen. «Es wird so sein» versprechen sie «… und dann ändert sich nichts mehr». Das klingt, verzeihen Sie, doch eher utopisch.
_____________
Benedikt Meyer ist Historiker und Autor.
www.benediktmeyer.ch

Mehr zum Thema «nah – fern» im Zeitpunkt 144
Auf der Insel, so wird berichtet, leben die Menschen in Verbänden von je dreissig Familien. Es gibt keinen privaten Besitz und die Gesellschaft ist klosterähnlich und hierarchisch organisiert. Gold interessiert die Utopier nicht, stattdessen hält sich jede Familie zwei Sklaven. Es gibt eine Schulpflicht, eine Arbeitspflicht, öffentliche Gesundheitsversorgung, Euthanasie und viele verschiedene Religionen, die einander tolerieren. Nur Atheisten werden schlecht behandelt. Wissenschaft und Kunst sind der Utopier liebste Hobbys. Ausserdem ist Utopia eine Welt ohne Anwälte.
Ist Utopia eine Gesellschaftskritik oder eine Satire? Es gibt Beweise für beides. More unterstützt manche Ideen der Utopier, andere laufen seinen eigenen fundamental zuwider. Ausserdem nennt er seinen Gesprächspartner «Hythlodaeus» (Possenreisser) und sich selber «Morus» (Narr). Es ist diese schillernde Vieldeutigkeit, die das Buch so unfassbar macht, dass es über Jahrhunderte hinweg immer wieder besprochen und neu interpretiert wird. «Utopia» wird zum eigentlichen Ur-Buch eines literarischen Genres.
Nach Utopia erscheinen alle möglichen Gesellschaftsentwürfe. Die meisten berichten von weit entfernten Inseln und skizzieren Gesellschaften, die einfacher, reiner und meistens auch klarer organisiert sind. Sie stehen für die Sehnsüchte nach einer besseren Welt – oder dem, was die Autoren dafür halten.
Im 19. Jahrhundert gibt es eine Wende in der utopischen Literatur. Die Landkarten sind beinahe vollständig; neue Küsten tauchen nicht mehr auf. Es wird immer deutlicher: Das war’s jetzt, mehr gibt es auf dieser Welt nicht zu entdecken. Zugleich aber verändert sich das Leben immer schneller. Nebst Sozialutopien tauchen Technikutopien auf, und statt in der Südsee liegt Utopia nun in der Zukunft. H.G. Wells und Jules Verne sind die Vordenker einer neuen Zeit und entwickeln mit «War of the Worlds» und «Le Voyage dans la Lune» Welten, die übermorgen schon Realität sein könnten. Sie interessieren sich weniger für ideale Gesellschaften als für die Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Die utopische Literatur mutiert zur «Science Fiction».
Diese erlebt immer dann einen Boom, wenn der Fortschritt besonders spürbar wird. So hinterliessen das Apollo-Programm und die Mondlandung deutliche Spuren in Literatur und Film. Die neuen Visionen aber sind nicht von Euphorie geprägt, sondern von Kritik. In «Star Wars» ist die Technik auf der Seite der Bösen, die Guten fliegen in klapprigen Raumschiffen und vertrauen auf eine spirituelle «Macht». In «Space Odyssey» wendet sich der Computer gegen die Menschen. Und bei «Star Trek» reist die Besatzung durch die Zeit zurück, um auf der Erde die Wale zu retten. Gerade das letzte Beispiel illustriert: Eigentlich handeln Utopien gar nicht von einer anderen Welt – sondern vom Hier und Jetzt.
Utopien entwickeln bildgewaltige Geschichten mit suggestiver Kraft. Aus Konjunktiven beschwören sie Wirklichkeiten herauf. «Imagine», sang John Lennon. Und heute? Welche Vision darf es sein? Grüne Natursehnsucht oder religiöser Fanatismus? Die Klimakatastrophe oder die Rettung durch den Fortschritt? Beschränkung aufs Nötigste oder hedonistische Konsumwut? Esoterischer Spritismus oder scientistischer Materialismus?
Utopien sind Seismographen unserer Sehnsüchte und Ängste. Und sie spiegeln unsere Sehnsucht nach dem Ende der Geschichte. Denn die Entwürfe – von More über Marx bis Musk – haben einen Hang zum Statischen. «Es wird so sein» versprechen sie «… und dann ändert sich nichts mehr». Das klingt, verzeihen Sie, doch eher utopisch.
_____________
Benedikt Meyer ist Historiker und Autor.
www.benediktmeyer.ch

Mehr zum Thema «nah – fern» im Zeitpunkt 144