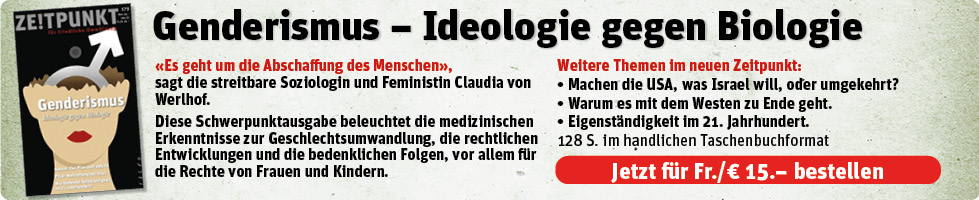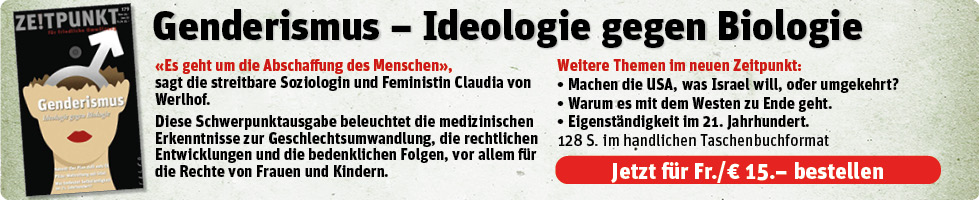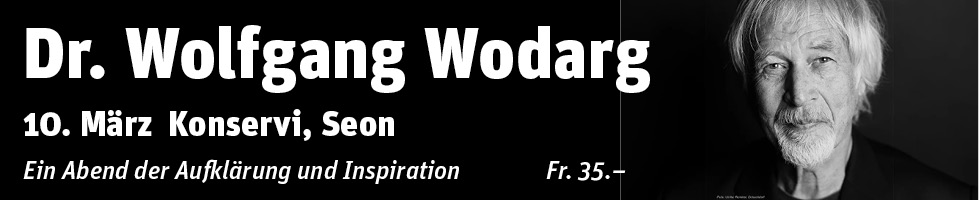Ich gebe zu, ich halte mich ungern an politisch gehypte Begrifflichkeiten. Sie kommen, sie gehen, und schwupps – vergessen. Wissen Sie noch, was letzte Woche die grosse Debatte war? Nein? Eben.
Heute wage ich es trotzdem. Denn dieser Satz hält sich hartnäckig im kollektiven Gedächtnis: «Wir leben im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat.» Sagte einst Deutschlands Bundespräsident.
Und wissen Sie was? Ich finde das grossartig! Warum? Weil man auswandern kann.
Ja, wirklich. Heutzutage setzt man sich (noch) ins Auto, und mit ein bisschen Navigationshilfe landet man ruckzuck in Gegenden, wo zweimal im Jahr dicke Bohnen wachsen. Keine Schlagbäume, keine Grenzposten. Niemand fischt einen heraus, solange man das richtige Auto fährt (Wohnmobile unter zwanzig Jahre sind eine Empfehlung) und Obacht(!) zudem eine unauffällige Hautfarbe hat.
Auch ich wollte das mal ausprobieren. Und wohin verschlägt es den modernen Auswanderer? Genau – nach Portugal, das europäische Lieblingsausland. Drei Tage Fahrt, und zack – heraus aus dem unzivilisierten Gebiet, wo man schon im Frühling am Weihnachtsbonus ackert, mitten hinein in den Alentejo.
Hier ist alles anders. Der Januar zeigt sich mit praller Sonne und auch mal mit Sprühregen, den die Einheimischen feiern wie Weihnachten. Wird es nachts doch mal kälter als 8 Grad, befeuert man den Kamin – die portugiesische Antwort auf die Wärmepumpe. Autofahren? Teuer. Nicht zuletzt wegen der unzähligen Schlaglöcher katastrophaler Strassenzustände. Aber Bahn und Bus? Spottbillig. Zeit ist hier relativ – Uhren gibt es, aber sie haben es nicht eilig.
Und dann diese Preise! Eine komplette Mahlzeit mit Oliven, Brot, gegrilltem Huhn, gigantischem Tomatensalat, zwei Gläsern Rotwein, Espresso und Mousse au Chocolat – 11,60 Euro. Ein Wunder! Der deutsche Tourist freut sich, solange er Algarve, Lissabon und Porto meidet. So weit so gut.
Aber was heisst es eigentlich wirklich, auszuwandern? Was will ich hier? Und wenn ja – warum?
Zur Steilküste? Bitte hier entlang.
Portugal ist ein Land der Kontraste. Auf der einen Seite atemberaubende Landschaften, gastfreundliche Menschen (von denen gefühlt jeder zweite Englisch spricht – im Gegensatz zu den französischen «wollen nicht» und spanischen «können nicht» Nachbarn). Die Lebensart ist entspannt: Vor der Kneipe parkt der SUV neben einem verrosteten Pick-up, auf dessen Ladefläche ein kauendes Schaf steht, und beide Fahrer trinken gemeinsam ihr Feierabendbier an einem Tisch.
Auf der anderen Seite steht eine politische Landschaft, die in den letzten Jahren massive Umbrüche erlebt hat. Viele junge Portugiesen verlassen das Land auf der Suche nach besseren Perspektiven, während gleichzeitig europäische, israelische und amerikanische Einwanderer herbeiströmen, die das vermeintlich einfache Leben suchen. Nebenbei treiben sie – wenig überraschend – die Grundstückspreise in die Höhe. So stiegen die Mietpreise in Porto allein im Jahr 2022/23 um 23 Prozent. Ich weiss nicht, ob München da mithalten kann.
Wer in einem Land Wurzeln schlagen will, muss Zeit und Geduld in die Sprache investieren. Portugiesisch mag melodisch klingen, doch es ist alles andere als einfach. Die Grammatik ist komplex, und die Sprache scheint keine Pausen oder Kommas zu kennen – ein Satz klingt wie ein einziges Wort. Als Fan der Linguistik kann ich den Sprachfluss nach ein paar Monaten zwar fast perfekt imitieren, was für Belustigung unter Partyfreunden sorgt, mich aber nicht wirklich weiterbringt. Also bleibt nur eins: zurück auf die Schulbank – allein schon, um die hiesige Bürokratie zu meistern, die ohnehin nicht für ihre Effizienz bekannt ist. Geduld ist auch hier mehr als eine Tugend. Vielleicht ist auch das der Grund, warum manche Kleingemeinschaften selbst nach Jahrzehnten in einer Art Bubble verharren. Einige dieser Orte wirkten auf mich mehr wie Strandgut als wie ein Aufbruch ins Neue.
Nepalesische Gastarbeiter, die in den letzten Jahren vermehrt nach Portugal gekommen sind, arbeiten oft unter prekären Bedingungen in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe – für unter 4 Euro pro Stunde. Sie leben am Rande der Gesellschaft. Ihre Geschichten erinnern täglich daran, dass das vermeintliche Paradies seine Schattenseiten hat.
Und dann ist da noch der Fado – die portugiesische Musik, die klingt, als hätte das Land Liebeskummer. Diese tiefe Melancholie spürt man nicht nur in den Liedern, sondern manchmal auch in den Gesichtern der Menschen. Es ist, als wäre etwas zerbrochen, als Portugal plötzlich keine Kolonialmacht mehr war und die halbe Welt nicht mehr zum einstigen Imperium gehörte. Bei dieser Musik fällt es schwer, sich nur an Apfelschorle zu halten – da hilft eigentlich nur, mit den anderen und einem Glas Medronho oder Rotwein mitzuleiden.
Und jetzt?
Machen wir uns nichts vor: Wir alle wissen, was Kapitalismus bedeutet. Die nüchterne Frage stellt sich auch hier: Wovon bezahlst du Brötchen und Marmelade, selbst wenn die Miete im Hinterland vorerst nur die Hälfte dessen kostet, was sie in Deutschland tut?
Noch funktioniert die Remote-Arbeit für mich als Allrounder – Film, Audio, Schreiben, Webseiten bauen. Doch ich muss mich beeilen. In zwei Jahren hat die KI 60 Prozent davon übernommen. Das rechnet sie mir ganz nüchtern vor – und dabei höre ich das leise, fiese Kichern des Fürsten der System-Finsternis. Sehr wahrscheinlich, dass bald auch all die Digitalnomaden in Lissabon oder an der Algarve es hören werden.
Und dann? Irgendwas mit Kork, Wein oder Oliven? Aboverwalter in einer Muckibude? Der dreihundertste Yoga-Retreat-Veranstalter des Landes? Tretbootverleiher?
Bei all den logistischen Fragen stellt sich mir nach ein paar Monaten eine viel fundamentalere: Wo ist meine Heimat?
Zum ersten Mal bekomme ich eine Ahnung davon, wie sich Flüchtlinge fühlen müssen – heimatlos, abhängig von fremden Ressourcen, Entscheidungen und einer Sprache, die man nicht versteht, auf einem wackeligen Boot mit dem Optimismus eines Schiffbrüchigen.
Wer glaubt, in der Fremde einfach nur ein besseres Leben vorzufinden, wird vielleicht wie ich schnell feststellen: Man nimmt sich selbst immer mit. Und das hat eine viel tiefere Dimension. Es braucht mehr als nur einen Fluchtgrund – es braucht eine Vision. Eine Vorstellung davon, wer man sein will, nicht nur davon, was man hinter sich lassen möchte. Sonst wird das vermeintliche Paradies nur eine Zwischenstation, bis die alte Unzufriedenheit einen auch hier wieder einholt. Ohne eigene Idee, ohne echtes Ankommen und Verbindung zu anderen bleibt man ewig Tourist – und irgendwann ist das Urlaubsgeld aufgebraucht.
Vielleicht ist genau das die eigentliche Erkenntnis, die man in der Fremde gewinnen kann: das Verständnis dafür, was Heimat wirklich bedeutet. Wie definieren wir Heimat?
Ich ahne, dass sie ein Zustand sein könnte – systemunabhängig, losgelöst von Klima und Koordinaten. Ein innerer Anker, der uns überall ankommen lässt. Und wenn wir diesen Zustand einmal erfahren haben, dann finden wir Heimat überall – selbst dort, wo es anscheinend längst keine Felder mehr zu bestellen gibt. Dazu vielleicht mehr in einer Fortsetzung.
Wobei mir das mit dem Tretbootverleih schon irgendwie gefallen würde.