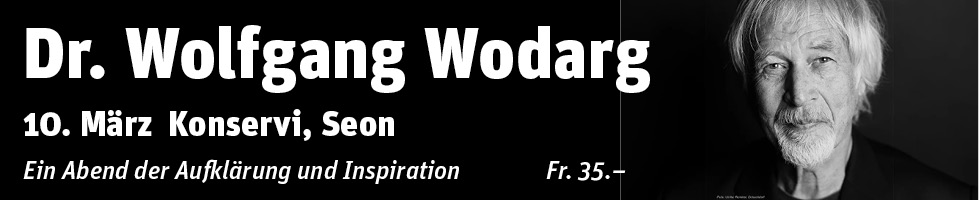Würde sich die nukleare Katastrophe, die sich derzeit in der Region Fukushima anbahnt, im nur 240 Kilometer südlich gelegenen Tokio ereignen, wäre ihr die größte Stadt der Welt schutzlos ausgeliefert. «Planspiele einer vollständigen Evakuierung Tokios gegenüber einer radioaktiven Wolke überschreiten vielfach die Grenzen einer managebaren Katastrophe», erklärt der Risikoforscher Jörn Birkmann vom Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit an der Universität der Vereinten Nationen in Bonn.
Evakuierung von 35 Mio. Menschen
Für ein Erdbeben oder eine Tsunamiwelle kann sich eine Megastadt durch Warnsysteme, Baustandards oder Notfall-Verhaltenstraining vorbereiten, was Japans Städte weit gründlicher getan haben als andere Megacitys in Erdbebengebieten wie etwa Istanbul oder San Francisco. Anders sieht es jedoch im Fall einer radioaktiven Wolke aus. «Vorher festlegbare Risiko- und Evakuierungszonen wie beim Tsunami gibt es hier nicht. Denn die von radioaktiven Wolken betroffenen Gebiete sind nur kurzfristig erkennbar, wie aktuell die Schwierigkeiten bei der Ausweisung von Evakuierungszonen um das Kraftwerk Fukushima zeigen», so Birkmann.
Es gibt keine detaillierten Notfallpläne, wie der Ballungsraum Tokios mit 35 Mio. Menschen auf eine größere nukleare Katastrophe reagieren könnte. Evakuierungsgebäude mit Luft- und Wassernotversorgung seien bei diesen Dimensionen undenkbar, ebenso eine Evakuierung. «Selbst wenn die Mehrheit der Einwohner die Stadt selbstständig mit Zug oder Auto verlassen würde, fehlt es an Notunterkünften und auch an temporären Alternativwohnungen für die Zeit danach. Zudem leben in Tokio sieben Millionen Menschen über 65 Jahre. Benötigt auch nur die Hälfte davon Hilfe, wären das noch immer 3,5 Mio.», erklärt der Experte für Verwundbarkeitsanalysen, Risikomanagement und adaptive Planung.
Auch Europa schutzlos
Deutlich wurde das Problem bereits 1995 beim Erdbeben von Kobe. «Es gab zu wenig Notunterkünfte und viele mussten teils im Freien bei Minusgraden übernachten. Auch jetzt gibt es große Probleme, Notunterkünfte mit grundlegender Infrastruktur wie Wasser, Heizung, Kommunikation in allen betroffenen Gebieten zur Verfügung zu stellen», so Birkmann. Evakuierungsmaßnahmen werden stets nur für deutlich weniger Menschen und kleinere Gebiete geplant und simuliert. «Bei einem extremen Hochwasser in Köln etwa spricht man nur von maximal 50.000 Personen, die an einen sicheren Ort gebracht werden müssen.»
Eine Atomkatastrophe im Stadtgebiet von Tokio würde somit alle Grenzen des managebaren Risikos sprengen. Allerdings wären laut Birkmann auch europäische Millionenstädte im Ernstfall kaum besser dran. «Natürlich gibt es Szenarien für Bombenattentate, Hochwasser oder kleinere radioaktive Verseuchungen. Eine durchgeplante Evakuierung großer Ballungsräume ist dabei aber kaum planbar.» Um ihr System unter enormem Stress aufrecht zu erhalten, sollten Städte überprüfen, welche ihrer Funktionen die überlebenswichtig seien, wozu der Experte die Versorgung mit Energie, Wasser und Nahrung zählt. «Moderne Mega-Citys in Industriestaaten sind erschreckend abhängig von der Verfügbarkeit von Strom.»
Lehre aus Japan: Risikokaskaden einplanen
Die Lehre aus der Situation in Japan ist für Birkmann, dass es nicht reicht, sich auf nur einen Gefahrentyp vorzubereiten. Neue Risiken treten häufig in Kaskaden auf, was besonders für Industrieländer und Megacitys zum Problem werden könne. «Japan erlebte ein massives Seebeben und einen Tsunami, der für eine ganze Region Notunterkünfte und Katastrophenhilfe erforderte, dazu versagten kritische Infrastrukturen wie die Stromversorgung, die in einem AKW massive neue Risiken auslöste. Die atomare Bedrohung, die nun alles andere in den Hintergrund gedrängt hat, zeigt die mangelnde Vorbereitung auf Risikokaskaden.»
Diese Erkenntnisse sollten in den Katastrophenschutz eingehen, fordert der Experte. «Einsatzkräfte wie etwa Feuerwehren sind bei kleinen, lokalisierbaren und zeitlich begrenzten Problemen schlagkräftig. Bei radioaktiven Unfällen mit Langzeitwirkung und räumlich nicht bekannter Ausbreitung versagen jedoch klassisch geprobte Mechanismen.» Die Aufteilung von Verantwortlichkeiten und Pflichten zwischen privaten Betreibern, Haushalten und dem Staat brauchen bessere Klärung, etwa in der Information oder im Notfallmanagement. «Zudem muss man prüfen, wie sich Privathaushalte auf derart 'undenkbare' Katastrophen vorbereiten können.»
Evakuierung von 35 Mio. Menschen
Für ein Erdbeben oder eine Tsunamiwelle kann sich eine Megastadt durch Warnsysteme, Baustandards oder Notfall-Verhaltenstraining vorbereiten, was Japans Städte weit gründlicher getan haben als andere Megacitys in Erdbebengebieten wie etwa Istanbul oder San Francisco. Anders sieht es jedoch im Fall einer radioaktiven Wolke aus. «Vorher festlegbare Risiko- und Evakuierungszonen wie beim Tsunami gibt es hier nicht. Denn die von radioaktiven Wolken betroffenen Gebiete sind nur kurzfristig erkennbar, wie aktuell die Schwierigkeiten bei der Ausweisung von Evakuierungszonen um das Kraftwerk Fukushima zeigen», so Birkmann.
Es gibt keine detaillierten Notfallpläne, wie der Ballungsraum Tokios mit 35 Mio. Menschen auf eine größere nukleare Katastrophe reagieren könnte. Evakuierungsgebäude mit Luft- und Wassernotversorgung seien bei diesen Dimensionen undenkbar, ebenso eine Evakuierung. «Selbst wenn die Mehrheit der Einwohner die Stadt selbstständig mit Zug oder Auto verlassen würde, fehlt es an Notunterkünften und auch an temporären Alternativwohnungen für die Zeit danach. Zudem leben in Tokio sieben Millionen Menschen über 65 Jahre. Benötigt auch nur die Hälfte davon Hilfe, wären das noch immer 3,5 Mio.», erklärt der Experte für Verwundbarkeitsanalysen, Risikomanagement und adaptive Planung.
Auch Europa schutzlos
Deutlich wurde das Problem bereits 1995 beim Erdbeben von Kobe. «Es gab zu wenig Notunterkünfte und viele mussten teils im Freien bei Minusgraden übernachten. Auch jetzt gibt es große Probleme, Notunterkünfte mit grundlegender Infrastruktur wie Wasser, Heizung, Kommunikation in allen betroffenen Gebieten zur Verfügung zu stellen», so Birkmann. Evakuierungsmaßnahmen werden stets nur für deutlich weniger Menschen und kleinere Gebiete geplant und simuliert. «Bei einem extremen Hochwasser in Köln etwa spricht man nur von maximal 50.000 Personen, die an einen sicheren Ort gebracht werden müssen.»
Eine Atomkatastrophe im Stadtgebiet von Tokio würde somit alle Grenzen des managebaren Risikos sprengen. Allerdings wären laut Birkmann auch europäische Millionenstädte im Ernstfall kaum besser dran. «Natürlich gibt es Szenarien für Bombenattentate, Hochwasser oder kleinere radioaktive Verseuchungen. Eine durchgeplante Evakuierung großer Ballungsräume ist dabei aber kaum planbar.» Um ihr System unter enormem Stress aufrecht zu erhalten, sollten Städte überprüfen, welche ihrer Funktionen die überlebenswichtig seien, wozu der Experte die Versorgung mit Energie, Wasser und Nahrung zählt. «Moderne Mega-Citys in Industriestaaten sind erschreckend abhängig von der Verfügbarkeit von Strom.»
Lehre aus Japan: Risikokaskaden einplanen
Die Lehre aus der Situation in Japan ist für Birkmann, dass es nicht reicht, sich auf nur einen Gefahrentyp vorzubereiten. Neue Risiken treten häufig in Kaskaden auf, was besonders für Industrieländer und Megacitys zum Problem werden könne. «Japan erlebte ein massives Seebeben und einen Tsunami, der für eine ganze Region Notunterkünfte und Katastrophenhilfe erforderte, dazu versagten kritische Infrastrukturen wie die Stromversorgung, die in einem AKW massive neue Risiken auslöste. Die atomare Bedrohung, die nun alles andere in den Hintergrund gedrängt hat, zeigt die mangelnde Vorbereitung auf Risikokaskaden.»
Diese Erkenntnisse sollten in den Katastrophenschutz eingehen, fordert der Experte. «Einsatzkräfte wie etwa Feuerwehren sind bei kleinen, lokalisierbaren und zeitlich begrenzten Problemen schlagkräftig. Bei radioaktiven Unfällen mit Langzeitwirkung und räumlich nicht bekannter Ausbreitung versagen jedoch klassisch geprobte Mechanismen.» Die Aufteilung von Verantwortlichkeiten und Pflichten zwischen privaten Betreibern, Haushalten und dem Staat brauchen bessere Klärung, etwa in der Information oder im Notfallmanagement. «Zudem muss man prüfen, wie sich Privathaushalte auf derart 'undenkbare' Katastrophen vorbereiten können.»