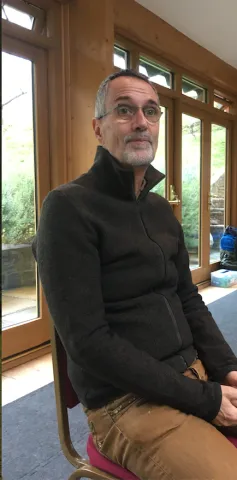Gemeinschaft (ob Nation oder Gruppe) ist nicht ein rein arithmetisches Problem. Eine Gemeinschaft ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Es genügt also nicht, Menschen, die zusammenkommen oder aufeinander angewiesen sind, aufzusummieren. Es ist vielmehr die Frage der Eingliederung der Einzelnen in ein sinnvolles Ganzes, so dass die persönliche Verantwortung durch die Art der Eingliederung angeregt, ja zur Entwicklung gebracht wird. Setzen wir darum die Parteien in Bezug zu ihrem Menschenbild und ihrem Gemeinschafts- und Freiheitsverständnis.
In der Politik herrscht grundsätzlich ein kollektivistisches Menschenbild. Der Mensch wird nicht als individuell handelnde Individualität erkannt, sondern in seinen Wesenszügen verallgemeinert. Wir haben uns daran gewöhnt, uns unter Gemeinschaft ein unklares «Wir» vorzustellen, ein Kollektiv als Summe von Subjekten, der wir, je nach Grösse, eine andere Bezeichnung geben. Es herrscht verständlicherweise die Angst, dass sich dieses «Wir» wieder in die Teufelsfratze der kollektiven Person verwandelt. Dabei vergessen wir aber, dass Menschen nicht unangeregt zu fremdenfeindlichen Monstern pervertieren, nein!, sie werden so gemacht durch politisch motivierte Reiz- und Lockmittel, die sich an den Untermenschen wenden, der in vielen noch stark ausgeprägt ist. Dem einzelnen Menschen werden seine Individualkräfte ausgetrieben und er, respektive sie – angstgenährt – wird zum/zur Staatsgetreuen gemacht.
Dabei wandelt die dominierende Politik Angst zu Furcht und lenkt die durch Angst erzeugte Aggression auf den gewünschten Feind. Keine Meute ist zum Übergriff fähig ohne einen Führer, der dazu anstachelt, anreizt und aufruft, weder die Deutschen, noch die Italiener, noch die Chinesen noch irgendeine andere Nation. Die oben erwähnten Grauen der Geschichte dürfen keiner Bürgerschaft zugeschrieben werden. Sie sind allesamt Ausdruck menschlicher Entfremdung – gewollter menschlicher Entfremdung – und Mittel politischen Kalküls.
Die politische Rechte hält immer noch fest an der Superioritätsdoktrin eines Volkes, einer «Rasse», einer Nation (die Überhöhung einer Gruppe über eine andere) oder eines Einzelnen. Das eigene Volk, welches, ausser im Krieg, inexistent ist, wird glorifiziert; der Krieg wird zum Exerzitium für Staatstreue. Dominanz und Abschottung werden zu Heilsversprechen. Der Begriff Souveränität wird genutzt, um sich in globale Isolation zu manövrieren, um vermeintliche globale Katastrophen abzuwenden. Deutlich wird, wie er mit dem des Souverän verwechselt wird.
Freiheit wird zum Recht, die eigene Stärke ausleben zu dürfen, auf Kosten aller. Diese Anmassung wird heute wie damals dadurch genährt, dass ultrareiche Oligarchen sich buchstäblich alles erlauben können und, wenn nicht als Souverän, so doch fernab von jeder Gerechtigkeit und losgelöst von jeder Gesellschaft agieren dürfen.
Der Souverän muss die Bevölkerung fest im Griff haben, wie von Machiavelli postuliert, im Zweifelsfalle besser gefürchtet. Auch hier wird das Misstrauen gegenüber der eigenen Bevölkerung deutlichst. Das «Volk» ist letztlich nur Mittel zum Zweck des eigenen Machterhalts. Das Grauen, welches aus solch Menschen verachtender Arroganz hervorgehen kann, wurde oben mit wenigen Beispielen festgehalten.
Doch auch der politischen Linken fehlt eine klare Konzeption des Menschen (selbst dann, wenn sie sich in ihrer gemässigten Form an ein humanistisches Menschenbild anlehnt). Das äussert sich gerade dadurch, dass sie am unausrottbaren Irrtum festhält, dass unsere sozialen Probleme nur wirtschaftlicher Natur seien. Sie negiert den Menschen als verantwortungsfähiges Wesen und fühlt sich durch die Geschichte darin bestärkt, die Bürger und Bürgerinnen bevormunden zu müssen. Zudem erlaubt das Ablehnen von Religion das Negieren des menschlichen Geistes. Querdenken – als Anspruch eines kritischen Geistes – gilt es, als gefährlich zu isolieren.
Statt individuelle Verantwortung bleiben der politischen Linken nur mehr Gesetze und Verordnungen. Als Antwort auf die Abschottung und Klassengesellschaft, die von der Rechten ausgeht, will die politische Linke die Gleichschaltung aller Bürger und Bürgerinnen (als vermeintlich klassenlose Gesellschaft), und aus Furcht vor der Vergangenheit müssen fast zwanghaft alle Lebensbereiche des Menschen kontrolliert (sprich reglementiert) werden. Sie vergisst darob völlig, dass soziale Verantwortung einen hohen Grad geistiger Selbständigkeit voraussetzt.
Die politische Mitte will eine Gesellschaft freier und gleicher Individuen und möglichst viel des Gemeinsamen privatisieren. So wollen die Liberalen weniger Staat. Gesellschaft gibt es nicht gilt oder höchstens als «zufällig zusammengewürfelter Haufen» von Personen, die zu keinen gemeinsamen Interessen fähig sind, was dann wiederum das Politische rechtfertigt. Darin liegt also ein Widerspruch, der alle anderen liberalen Ansprüche nichtig macht. Wir sind zwar als Menschen, nicht aber als Individuen gleich (sonst wären wir keine Individuen). Und daraus folgt, dass wir eben auch nicht alle gleich frei sind, vor allem nicht nach äusseren Maßstäben, und diese sind relevant, wenn es um den Erwerb von Privateigentum geht. Leben und Leben lassen wird Credo eines Freiheitsverständnisses, welches unausgesprochen proklamiert: «Jede und jeder soll machen, was er oder sie kann!» Diejenigen, die «mehr können», bedienen sich an den Commons.
Der Mensch als freies Individuum bedeutet das Ende des Politischen
Alle politischen Strömungen ignorieren, dass gemeinschaftsbildende Kräfte nur aus Individualkräften entstehen können. Dafür müssen diese aber zugelassen und gefördert werden, was zu immer mehr individueller Verantwortung dem Gemeinsamen gegenüber führen kann und sich in letzter Konsequenz jeglicher Fremdbestimmung verweigern muss. Das würde unweigerlich zum Ende des Politischen führen. Der Politikwissenschaftler John Gray kommt in seinem Buch mit dem entlarvenden Titel «Straw Dogs: Thoughts on Humans and other Animals» (übersetzt: Strohhunde – Gedanken über Menschen und andere Tiere) (sic) zum Schluss, dass keine politische Richtung zu weniger Staat führt. Damit weniger Staat nicht zu einem gefährlichen Vakuum führt, braucht es ein neues Verständnis von «Governance» (übersetzt etwa: Steuerung), welches das Politische ersetzt. So kann sich zum Beispiel individuelle Verantwortung durchaus in privaten Nutzungsrechten ausdrücken, aber nur dann, wenn diese Verantwortung sich auch in einer Verantwortung gegenüber dem Gemeinsamen ausdrückt und sich somit einschränken lässt.
Das Richtig tun liegt jenseits politischer Opportunität
Alle Parteien misstrauen letztlich dem Menschen, sie klammern aus, dass der Weg zu Gemeinschaft – ob wir das nun Staat, Nation oder Kommune nennen – nur über das Individuum und dessen individuelle Verantwortung führen kann. Ohne individuelle Verantwortung braucht es immer mehr Gesetze, Kontrolle und letztlich Gewalt, letztendlich das Abtöten des letzten Restes von menschlicher Individualität und Menschlichkeit.
Was dem Politischen also entgegenläuft, ist das urteilsfähige Individuum. Darum wird es bekämpft. Alle Versuche des politischen Spektrums, das Individuum und seine Leistungen einem kollektiven System einzugliedern, sei es durch Gleichschaltung oder durch den «freien» Wettbewerb, um so mehr Lebensqualität zu erreichen, sind letztlich gescheitert und werden weiterhin scheitern, weil sie der menschlichen Wesenheit in ihrem Gesamtcharakter nicht gerecht werden. Das politische Gedankengut reicht schlicht nicht aus, um die Spannung von Individuum und Gemeinschaft zu lösen. Das Politische müsste anerkennen, dass wir Menschen mündige und urteilsfähige Wesen sind (ungleich dem Instinkt getriebenen Tier, welches automatisch das Richtige tut) und den Prozess wagen, Urteilsfähigkeit zu fördern. Das jedoch würde letztlich das Ende des Politischen bedeuten.
Zum ersten Teil des Essays:
Eine friedliche und umweltbewusste Menschheit entsteht – wenn überhaupt - von unten nach oben, nicht umgekehrt!
Gegenwärtig ist politisch ein starker Trend zur Globalisierung spürbar, mit der logischen Pendelbewegung zu einem sich stärker in Szene setzenden, populistischen, politisch motivierten Nationalismus. Die einen wollen Macht noch weiter nach oben – fern dem Menschen – rücken, die andern bauen auf Verdummung. So sehr sich diese Bewegungen gegenseitig bedingen, so unerfreulich und unnötig sind sie. Sie halten das politische Karussell am Laufen und die Macht entfremdet.
Parteien werden in Zukunft noch mehr Staat benötigen, noch mehr Bevölkerungskontrolle und entsprechende Gesetze, um ihre Ideologie künstlich am Leben zu erhalten und sich zu schützen. Wollen wir das? Losbasierte Demokratie kann ein Ausweg sein, denn sie muss sich – ihrem Zweck der Freiheit gerecht wertend – auf den Bereich des Gemeinsamen beschränken. Da die Governance durch Losverfahren für eine befristete Zeit bestimmt wird, werden Wahlk(r)ämpfe überflüssig. Das Losverfahren macht den Weg frei zum notwendigen, den Menschen gemässen Umbau des Wir.
Unsere bisherigen Betrachtungen führen zum einen Schluss, dass eine Gruppe von ideologisch Gleichgesinntennimmer für sich die Macht beanspruchen kann, Realität für alle zu definieren. Im letzten Teil werden wir sehen, dass eine statistisch relevante Repräsentanz durch das Politische nicht mal dann zustande kommen würde, wenn sich alle Parteien vereinen würden.
Die Illusion der Repräsentanz
Der Versuch einer Demaskierung des Politischen führt uns wieder zurück zum Thema der Repräsentanz. Jeder Souverän – egal ob eine Partei oder eine Person – nimmt für sich in Anspruch, den Staat zu repräsentieren, das heisst, die Stimme eines Landes zu sein; das eigene Tun als «Wille» des Volkes zu verkaufen und letztlich die eine Macht zu sein, die den Volkswillen ignoriert. Doch hier wird der Begriff der Repräsentanz bewusst nur einseitig verwendet, als Zeichen der Macht. Repräsentieren jedoch bedeutet noch etwas anderes, rein numerisches: Repräsentieren meint, dass eine Regierung eine Bevölkerung dahingehend abbildet, dass von einer statistisch relevanten Repräsentanz gesprochen werden kann.
Denn legitim wäre ja nur eine Regierung, die in ihrer Zusammensetzung die Zusammensetzung der regierten Bevölkerung wiedergibt, also zum Beispiel: mehr Frauen in der Bevölkerung, mehr Frauen in der Regierung; ein Drittel einer Bevölkerung unter 30 Jahren, ein Drittel der Regierung unter 30 usw. Alles andere ist nicht mehr zeitgemässer, illegitimer Regierungsanspruch. Wahl- und somit parteibasierte Regierungssysteme bilden keine Bevölkerungen ab und zwar nicht mal dann, wenn alle Parteien gemeinsam regieren würden. Sie reihen sich somit gut in alle vorherigen Regierungssysteme ein, von denen keines auch nur annähernd Bevölkerung abbildete. Diesem Anspruch wollte Regieren zwar nie entsprechen, doch wäre es heute der einzige noch legitime Regierungsanspruch.
Was im Politischen mit Repräsentanz gemeint ist, soll anhand der Ausführungen von Rosalind Fuller beschrieben werden. Sie stellt politische Repräsentanz anschaulich in ihrem Buch «Beasts & Gods» dar und nimmt dabei die die Kunst zu Hilfe. Nehmen wir eine Zeichnung eines Baumes. Je genauer der Baum gezeichnet wird, desto mehr können wir sagen, die Zeichnung repräsentiert einen Baum. Der Betrachtende erkennt sofort: Das ist ein Baum, kein Hund, kein Ei – sondern ein Baum. Vielleicht ist die Zeichnung so detailliert, dass aus der Zeichnung sogar die Art des Baumes zu erkennen ist.
Nun gibt es auch eine andere Möglichkeit, Repräsentanz darzustellen, eine, die der politischen Realität näherkommt, weil sie ebenso künstlich ist. Dabei ist der Repräsentant ein reiner Platzhalter und nicht mehr Abbild der Wirklichkeit (zum Beispiel einer Bevölkerung). Um beim Bild des Baumes zu bleiben: Statt einen Baum zu zeichnen kann der Künstler beschliessen, dass eine gerade Linie einen Baum repräsentieren soll. Da braucht es von den Betrachtenden schon etwas mehr Abstraktionsvermögen und – was weit wichtiger ist – die Bereitschaft, diese Linie als Repräsentant eines Baumes zu akzeptieren, denn sichtbar ist es nicht.
Hier handelt es sich also um ein Symbol. Eine gerade Linie soll einen Baum symbolisieren. Relevant ist das allerdings nur für diejenigen, die a) das wissen und b) dieses Symbol als Repräsentant eines Baumes akzeptieren. Wir können also sagen, je weiter weg der Repräsentant vom Echten ist (ein Symbol), desto künstlicher ist die Repräsentanz. Und genauso verhält es sich mit der Politik: Sie führt zu keiner wirklichen Repräsentanz. Politiker, egal welcher Seite sie angehören, sind ein künstliches Symbol der Macht. Eines, das – wenn nicht mehr genügend Bürgerinnen und Bürger bereit sind, Parteien als Symbol für Macht anzuerkennen – sich nur noch durch Gewalt an der Macht halten kann.
Wie bereits erwähnt, hat es kein Regierungssystem je geschafft, die Bevölkerung tatsächlich abzubilden, auch nicht wahlbasierte. Die meisten scheitern schon an der Frauenquote. Der weltweit minimal höhere Anteil von Männern gegenüber Frauen (gemäss WHO 101:100) bildet sich nicht mal annähernd in einer Regierung ab. 2021 soll der Anteil der Frauen in Regierungspositionen gerade mal bei 25 % gelegen haben (s. UN Women und Inter-Parlamentary Union IPU).
In einem wahlbasierten Regierungssystem kann nur gewählt werden, wer sich zur Wahl stellt. Das sind und bleiben, in der absoluten Mehrzahl, Männer. Der Wille zur Macht entspricht Männern mehr als Frauen. Es ist dann auch dieser Wille zur Macht, welcher die Politik anfeuert und sie am Leben hält. Einmal gewählt, richten sich alle Handlungen der Politiker auf die Wiederwahl (solange bis sich lukrative Alternativen abzeichnen).
«Nach der Wahl ist vor der Wahl», bringt das Spiel des Politischen auf den Punkt. Quotenregelungen wären ein künstliches Mittel, um dieses künstliche System am Leben zu halten. Ein anderes wäre statistisch relevante Repräsentanz, wie sie der Vater der Demokratie, Aristoteles, festlegte. Der Weg würde für den Willen zur Sorgfalt geebnet, anstelle dem zur Macht (was eher dem weiblichen Prinzip entspricht).
Auch betreffend Alter, Berufsbildung und Einkommen wird die Bevölkerung nicht abgebildet. Alte, überdurchschnittlich gebildete (weisse) Männer regieren auch heute noch, zusammen mit der Macht des Geldes. Erinnern wir uns: Aristoteles legte fest, dass der Demokratie am besten gedient sei, wenn die Mehrheit der Regierenden arm, ungebildet und frei seien. Er wies uns bereits vor über 2000 Jahren darauf hin, dass ein Volk nur dann gerecht repräsentiert wird, wenn es die Bevölkerung erfasst – und die war damals mehrheitlich arm und ungebildet (ein Studium wird zur vernünftigen Urteilsbildung massiv überschätzt). Denn wer frei ist, ist ungebunden in seinem Urteil, ungebunden gerade auch vom Geld (denn Geld macht abhängig). Das sind die zwei Säulen der Demokratie; eine quantitative und eine qualitative. Alles andere ist Augenwischerei.
Gemäss IDEA (International Insitute für Democracy and Electoral Assistance) und Vereinten Nationen soll die durchschnittliche weltweite Wahlberechtigung bei 60 – 80 % der Bevölkerung liegen. Wir müssen uns also immer vergegenwärtigen, dass in keinem Land die Wählerschaft die tatsächliche Bevölkerung abbildet. Je nachdem nehmen 20 – 40 % einer Bevölkerung nicht an Wahlen teil. Sie alle werden nicht repräsentiert.
Wenn wir nun weiter betrachten, dass der Anteil von Mitgliedern in einer Partei an einer Gesamtbevölkerung nur zwischen 1 bis maximal 5 % liegt (gemäss IDEA), können wir nicht von einer statistisch relevanten Repräsentanz durch wahlbasierte politische Systeme sprechen und zwar nicht mal dann, wenn alle Parteien gemeinsam an der Regierung (Exekutive) beteiligt wären.
Wenn wir uns nun ausrechnen, dass sich bei einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung von 70 % die Stimmen auf nur zwei Parteien verteilt werden, dann entfällt bei einem absoluten Mehr die Hälfte aller Stimmen plus 1 auf die Gewinner (also grob gerechnet maximal 36 %).
Es ist also das rechnerische Ergebnis einer rein numerischen Tatsache, dass keine Regierung je die Mehrheit eines Volkes vertritt, vertreten hat, vertreten wird. Doch selbst die an einer Wahl Beteiligten können leer, sprich nicht repräsentiert ausgehen und zwar dann, wenn Wähler und Wählerinnen Kandidaten und Kandidatinnen wählen, die nicht gewählt werden (weil sie die vorgegebene Mindeststimmzahl nicht erreichen). Sie haben dann in der folgenden Regierungsperiode ebenfalls keine Stimme.
Entsprechend kann der Ausgang einer Wahl für Wählende sein: Doppelte Nicht-Repräsentanz, wenn weder die gewählte Person noch die gewählte Partei gewinnen. Nicht-Repräsentanz wenn zwar die Partei, nicht aber die gewählte Person gewinnt. Volles Symbolum, wenn sowohl die gewählte Person, als auch die gewählte Partei gewinnt. Und trotzdem ist diese Repräsentanz keine gerechtfertigte, da sie in keiner Art und Weise eine Bevölkerung abbildet, keine statistisch relevante Repräsentanz hat.
Die Angst vor dem Diktat der Mehrheit habe ich bereits in meinem Essay über Demokratie als unbegründet zurückgewiesen. Demokratie hat die Aufgabe, für die Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Bevorzugungen oder Ausgrenzungen haben in einer Demokratie also schlicht keinen Platz. Ihr Ziel ist die Freiheit aller. Heute sind wir abhängig vom Diktat der parteipolitischen Minderheit, die – einmal an der Macht – unsere Freiheiten immer mehr beschneidet, um an der Macht zu bleiben. Das ist für aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger weder nachvollziehbar, noch zeitgemäss, noch befriedigend.
Politische Versprechen gelten nichts, wie uns Wahlen immer wieder zeigen; davon ist das Versprechen einer gewählten Regierung, die ganze Bevölkerung vertreten zu wollen, nicht ausgenommen. So bleibt es bei der künstlichen, machtbasierten Repräsentanz durch politische Minoritäten, als die Wenigen, die das Recht für sich beanspruchen, für alle sprechen zu dürfen, auch wenn sie (rein prozentual) in jeder Bevölkerung eine Minderheit sind, waren und bleiben werden.
Politische Wahlversprechen gelten nichts
Warum lassen wir das Politische noch zu? Seit Menschengedenken sind wir gewohnt, geführt zu werden; früher durch überlebenssichernde Weisheit, heute durch unterdrückende Machtbesessenheit. Als sich entwickelnde Menschheit müssen wir letztendlich an dem Punkt ankommen, an dem wir die Governance als mündige Bürgerinnen und Bürger selber in die Hand nehmen, wenn wir nicht «mehr desselben» wollen. Von dieser Bestimmung wusste schon Aristoteles, als er in weiser Voraussicht Demokratie definierte.
Seither wurde im Politischen viel an ihr herumgebastelt; sie wurde als «liberal» oder «direkt» den und den Bürgerinnen und Bürgern schmackhaft gemacht. Wahlen wurden eingeführt, um auch weiterhin den Privilegierten die Macht zu sichern, das wusste schon Aristoteles. Doch Wahlen sind nun definitiv ein Auslaufmodell, Zeichen einer Ära des Regiert-Werdens, einer Ära, die sich dem Ende zu neigt.
Mehr Desselben bringt nur eines hervor: mehr Desselben. Das gilt für jedes System. Es ist gerade die Demokratie, die das Gleiche auf den einzig richtigen, da sinnvollen Platz verweist, als Mitglieder einer Gemeinschaft und letztlich als Mensch unter Menschen. Sie drückt sich in der Rechtsgleichheit aus und lässt uns frei den ultimativen Weg beschreiten, der uns als Mensch (zwecks unseres Menschseins) zugemutet werden muss: der Weg zur menschlichen Individualität.
Statt Politik
Das Politische kann zusammengefasst werden als die Auseinandersetzung und der Kampf um die Macht durch das Wort. Fällt diese Macht als Herrschaftsrecht weg, verkommt das Politische zum Geplänkel Möchtegern-Mächtiger. Wahlen als Mittel zu Macht wird Teil politischer Geschichte.
Mögen zukünftige Generationen über die Naivität staunen, dass Wahlen die Fähigsten hätten in die Regierung bringen sollen. Dass sie als Mittel der Aristokratie einfach zu korrumpieren sind, benannte schon Aristoteles. Wenn Macht auf Machen reduziert wird, kommen wir unweigerlich zum handelnden Individuum, denn dieses ist das Einzige, was tut.
Die Gemeinschaft – ob wir sie nun Staat, Nation, Land, Volk, Kommune oder Globales Modul nennen – bildet nur Urteil. In der Governance geht es also um Urteilsbildung. Zur Urteilsbildung brauchen wir Evidenzen, nicht politisch motivierte Meinungen. Jeder frei denkende Mensch ist in der Lage, aus unzensierten Evidenzen ein Urteil bilden zu können. Im Austausch mit denen, die in der Governance die Bürgerinnenschaft tatsächlich statistisch relevant abbilden, finden sich die besten Urteile. Dieser Austausch aber bezeichnet Dialog, nicht Politik. Eine statistisch relevante Governance wird sicher bessere Urteile bilden, als politisch motivierte Minderheitsregierungen. Wie diese Governance zukünftig aussehen kann, hängt von der Grösse einer Gemeinschaft ab und ist Inhalt eines nächsten Essays.