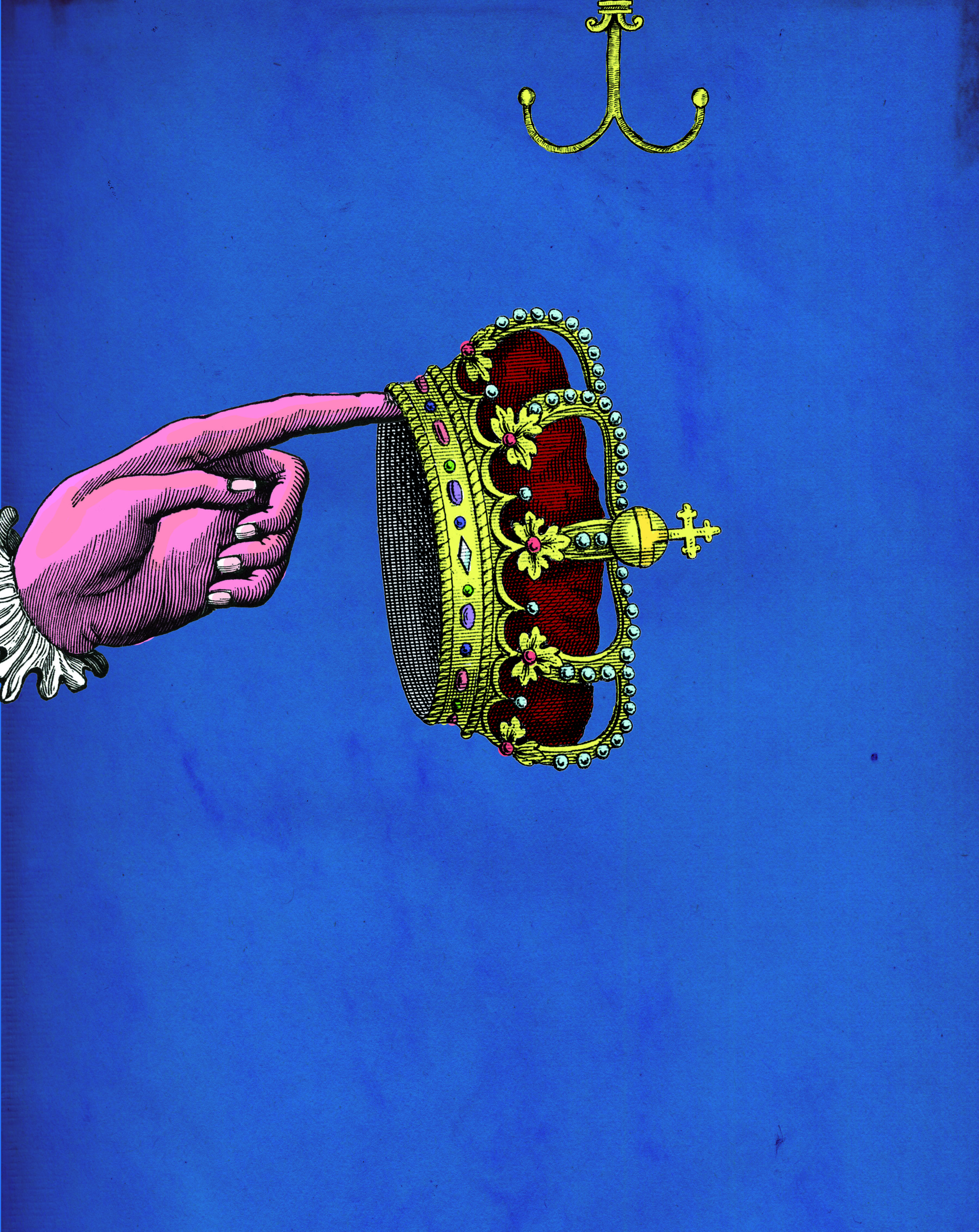Wir leben in einer Welt, in der noch immer die Meinung dominiert, Verantwortung sei «Pflicht und Schuldigkeit» – ein Müssen also. Verantwortung zu haben heisst demnach entweder im angenehmen Sinne, als Chef oder Königin Macht auszuüben. Oder es heisst im unangenehmen Sinne, Fehler ausbaden zu müssen. Wer Verantwortung hat, soll also aufpassen, nichts falsch zu machen, weil er sonst zur Rechenschaft gezogen wird. Alles in allem eine wenig attraktive Sache.
Tatsächlich wird es immer schwieriger, Menschen für ehrenamtliche Arbeit oder politische Ämter in Gemeinden zu gewinnen. Die Lust auf Verantwortung scheint zu schrumpfen. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern basiert auf einer präzisen Logik und wird dadurch erklär- und veränderbar. Doch erst zu den Gründen der zunehmenden Verantwortungslosigkeit.
Der Mensch – Opfer der Umstände?
Verantwortung kann durch Umstände vernichtet werden. Dies illustriert der Psychologe Philip Zimbardo in seinem Buch1 über die Psychologie des Bösen auf eindrückliche Weise. Er zeigt, dass sich Boshaftigkeit oft auf die Macht der Umstände zurückführen lässt und nicht unbedingt Eigenschaft einer Person ist. In seinem Gefängnis-Experiment untersuchte er, wieweit zugewiesene Rollen und Aufgaben die Menschen verändern. 24 Studenten wurden zufällig in zwei Gruppen, Wärter und Gefangene, eingeteilt, um in einem nachgebauten Gefängnis ihre Aufgaben wahrzunehmen. Schon am zweiten Tag wurden die Gefangenen in schockierender Weise misshandelt, bis hin zu Kleidungs- und Schlafentzug. Nach fünf Tagen musste das Experiment wegen schwersten Grausamkeiten abgebrochen werden.
Im genannten Experiment wurde die Boshaftigkeit extrem schnell offensichtlich. Oft jedoch passiert Ähnliches ganz subtil und unmerklich. Gegenüber der Natur zum Beispiel. Sie, die uns ernährt und Lebensraum gibt, wird zum Vergnügungspark und Ort der Selbstdarstellung degradiert. Der Mensch hat sich vom dankbar staunenden Bewunderer zum egoistischen Nutzniesser gewandelt. Das Beispiel des Mont Blanc macht das deutlich.
Der Mont Blanc wird jedes Jahr von etwa 30'000 Kletternden besucht. Das sind 80 Menschen pro Tag. Vom Ort ehrfürchtiger Bewunderung wurde der mit 4810 Metern höchste Berg Europas zum Gegenstand der Unterhaltungsindustrie. Im Jahre 2012 veranstaltete ein Sportartikelproduzent auf seinem Gipfel ein Konzert mit der französischen Sängerin ZAZ. Dazu wurde ein Kontrabass auf den Berg gehievt. Später stellten zwanzig Schweizer einen mobilen Whirlpool auf den Berg, um aus Plausch ein Bad zu nehmen. Der spanische Crossläufer und Geschwindigkeitsfetischist Kilian Jornet rannte medienwirksam in knapp fünf Stunden die 3813 Höhenmeter von Chamonix auf den Gipfel und zurück. Obwohl man den einzelnen BerggängerInnen nichts vorwerfen kann, verändert die Masse den lebendigen Sinn der Natur. Die Beispiele zeigen, dass ein ungünstiger Kontext die Verantwortung vernichten kann, aber auch, dass der Mensch in der Lage ist, den grundlegenden Sinnkontext zu verändern. Doch genauso wie Verantwortung vernichtet wird, kann sie in einem lebensgünstigen Umfeld neu wachsen. Die Welt und der Mensch sind keine festen Grössen. Wir Menschen sind geprägt durch Einflüsse und prägen selber durch unseren Einfluss. Um das bewusst und lebensförderlich zu tun, ist es hilfreich, die Schöpfer von Verantwortungslosigkeit zu kennen.
Vier aktive Verantwortungskiller
Zwei grosse Akteure von Verantwortungslosigkeit sind offensichtlich: Es ist dies einerseits die Funktionalisierung und Spezialisierung. Sie macht es den Einzelnen praktisch unmöglich, das Ganze zu überblicken und Verantwortung zu übernehmen für die Integration seines Handelns in die Natur und Zukunft kommender Generationen. Der andere grosse Akteur ist die grassierende Individualisierung unserer Zeit, deren Trugschluss lautet: «Wenn jeder für sich schaut, geht es allen und dem Ganzen gut.» Beide Entwicklungen engen den Blick ein und machen, dass wir die Verbindung zur «Landschaft», in der wir stehen, verlieren.
Nicht weniger wirksam aber sind zwei Verantwortungskiller, die still und heimlich arbeiten. Der erste ist die Abstraktion. Experten haben mit ihren Formeln und Prinzipien wissenschaftlich recht; was im Alltag daraus wird, ist die Sorge der andern. Angestellte sind für die Auswirkungen ihrer Handlungen nicht mehr zu behaften, denn sie treten im Namen ihrer Institution auf. Wenn Verantwortung dem Leben gegenüber fehlt, wird das Böse banal, wie Hannah Arendt erkennen musste. Der Judenverschicker Eichmann hat die Verantwortung für seine Pflicht übernommen, nicht aber die Lebensverantwortung, denn er hat ausgeblendet, dass er Tausende von Menschenleben vernichten half. Es fehlte ihm die doppelte Lust, die es dazu braucht: Lust, auf den Anderen zu hören, und Lust, Lebendigkeit zu wecken. Der zweite versteckte Verantwortungskiller ist omnipräsent. Die meisten von uns tauchen am Tag ihrer Geburt darin ein, so vollumfassend wie in die Luft, die wir atmen. Gemeint sind Druck und Dominanz, zwei vitale Energieformen, die im menschlichen Denken und Handeln meist das Zepter führen.
Druck und Härte versus Verantwortungslust
«Wer lernen soll, muss Druck erfahren», so lautet ein oft praktizierter Glaubenssatz. Wer führt oder erzieht und dabei an Verständnis und Geduld spart, baut Druck auf. Wenn die Durchsetzung nicht klappt, wird der Druck meist erhöht und Sanktionen folgen. Mit dem Ergebnis, dass die Lust auf Lernen, Arbeiten und Kooperation schwindet. Die Spirale der Leblosigkeit dreht. Wir aber kommen als hochlebendige Wesen zur Welt, die Lust haben, alles aufzunehmen, was dieser Lebendigkeit dient. Wenn man sie uns mit einer drohenden Geste oder einem unstimmigen Ton rauben will, wehren wir ab – instinktiv. Wenn etwas jedoch lebendig und lustvoll ist, tun wir alles: Wir räumen auf, versuchen noch so schwere Lasten zu tragen und stürzen uns in Abenteuer. Mehr noch: Wir übernehmen Verantwortung für alles. Unter einer Bedingung: Es muss lebendig sein. Das heisst, Zukunft zu generieren, nicht sie zu vernichten.
Die ursprüngliche Verantwortung
Der in diesem ursprünglichen Sinne verantwortungsvolle Mensch lässt sich weder durch die Umstände noch durch die Versuchung der Macht davon abhalten, jedes Detail bedingungslos mit Vitalität zu füllen. Er ist stolz auf integres Handeln und prüft jede einzelne Tat darauf, ob sie der Welt, den eigenen Ansprüchen, den Anliegen der anderen und der Zukunft der Lebendigkeit einen Mehrwert bringt.
Dazu Beispiele aus Politik und Kirche: Der vormals deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und die ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, gerieten unter Druck, weil sie bei ihrer Doktorarbeit abgeschrieben hatten. Beide wollten ihre Ämter behalten und traten erst unter grossem politischem Druck von ihren Posten zurück. Ganz anders Margot Kässmann: Sie trat 2010 freiwillig von ihrem Amt als lutherisch-evangelische Bischöfin zurück, weil sie mit 1.5 ‰ Alkohol im Blut ein Rotlicht überfahren hatte. Sie entschied sich für den Rücktritt aus Lust an der eigenen Integrität, ohne Druck von oben. Sie handelte nicht aus Pflicht, sondern aus Lust an Stimmigkeit und brachte das Detail der Handlung in Einklang mit den abstrakten Prinzipien des Geistes. Es ging ihr, wie sie sagt, «um die Achtung vor mir selbst und meiner eigenen Geradlinigkeit». Das ist Stolz auf Lebendigkeit – die ursprüngliche Verantwortung!
Was ist die Ganzheit, die uns leitet?
Solcher Stolz, wie ihn Margot Kässmann ausdrückt, wurzelt in einer Ganzheit, die uns leitet. In geschlossenen Gesellschaften mit klaren Freund-Feind-Bildern waren es göttliche Instanzen, Priester oder Könige, welche die Gesamtausrichtung definierten. Moral, Druck und die Zwillinge «Lohn und Strafe» waren Methoden, um die Menschen zu führen.
Heute, in demokratischen Gesellschaften, entscheiden die Individuen, woran sie sich orientieren. Dabei sind Wille und Bedürfnisse der Individuen ausschlaggebend. Diese Gesellschaftsform ermöglicht grosse persönliche Freiheit und Wohlstand einerseits, Kriege und radikale Zerstörung der Lebensgrundlagen andererseits. Die Methode dahinter besteht darin, die momentanen Entscheidungen und die langfristigen Auswirkungen zu trennen. Jeder Bürger, jede Bürgerin darf jetzt einkaufen, der zukünftige Preis dafür ist die Vermüllung der Weltmeere.
Unsere Lebenswelt aber braucht eine neue Ausrichtung, jenseits von objektiven Gesetzen und subjektiver Einschätzung – eine vitale Leitlinie, welche die Grundlage unseres Lebens im Visier hat und sie schützt. Um auch künftig auf diesem Planeten leben zu können, ist es notwendig, dass wir jede Handlung darauf prüfen, ob sie Leben schafft oder Zukunft vernichtet. Es gibt ein praktisches Konzept, welches diese Leitlinie heute schon konsequent umsetzt: Die Flow-Pädagogik.
Die Lust des Lebens auf mehr Leben – Flow
In der Natur ist diese vitale Leitlinie ständig wirksam. Wir sehen sie im Gras, das unter der Asphaltdecke in Richtung Licht gezogen wird und sich so einen Weg bahnt. An diesem Sog der Vitalität orientiert sich auch die Flow-Pädagogik. Dabei arbeitet sie nicht mit Härte, Druck und Dominanz, sondern mit dem Bewusstsein, ursprünglichen Ressourcen und vitalen Energien. Beispiele dafür sind Sinn, Geborgenheit oder innovative Kreativität. Der Zustrom subtiler Energie, der unsere Existenz in jedem Moment aufrechterhält, ist der Flow. In geheimnisvoller Weise schafft er Lust und Begeisterung als Basis für jede Tätigkeit. Er ist die Lust des Lebens an mehr Leben. Dieser existentiale Flow ist kein Gefühl, weil er auch wirkt, wenn wir ihn nicht direkt erfahren. Er unterscheidet sich deshalb vom psychologischen Flow, den Mihaly Csikszentmihalyi in seinem Buch «Das Flow-Erlebnis» untersucht. Monty Roberts, der berühmte Pferdeflüsterer, war der erste, der mit dem existentialen Flow arbeitete. Die Flow-Pädagogik erklärt nun zusätzlich zur Praxis auch die Wirkweise des existentialen Flow. Wo der Funke springt, erübrigt sich jede Motivation. Wo ein Sinn einleuchtet, braucht es keine Überzeugungsarbeit; wo Neugier geweckt wird, ist der Geist offen für alles, was kommt.
Wenn die Arbeit mühsam ist, der persönliche Austausch harzt und uns alles anstrengend wird, dann ist der Flow zwar nicht verschwunden, aber der Zugang zu ihm verschüttet. Der Volksmund sagt dann, «es klemmt».
Ein Beispiel aus der Praxis: Der Schüler Remo, der sich der Zusammenarbeit mit seiner Betreuerin verweigerte, wurde von dieser unter Druck gesetzt: «Stell dich nicht so an. Ich bin extra gekommen, um mit dir Mathe zu üben!» Dadurch wurde für Remo die vitale Notwendigkeit, sich zu verweigern, verstärkt. Es eskalierte. Die hinzugezogene Flow-Pädagogin erkannte das tiefere Anliegen hinter Remos Widerstand: Er wollte nicht blossgestellt werden und vor den andern nicht als einzig Hilfsbedürftiger dumm dastehen. Die Flow-Pädagogin nahm Remos Widerstand ernst, «verkaufte» die Zusatzbetreuung als Privileg und bot dieses auch anderen, starken Schülern an. In der Klasse entstand sofort ein Sog, denn Privilegien sind stets attraktiv. Sobald diese Umdeutung gelungen war, kämpfte auch Remo um das Privileg der Zusatzbetreuung. Vollkommen ohne Druck und Moral wurde Remos Widerstand gewandelt.
Wenn erst einmal Begeisterung, Intensität und Lebensfreude zirkulieren, sind wir Menschen bereit für Höchstleistungen oder, anders gesagt, bereit für Verantwortung im ursprünglichen Sinne.
Die Pädagogik der Vitalität braucht uns alle
Um Menschen dazu zu bringen, ihre Verantwortung gerne und aus eigenem Antrieb zu übernehmen, reichen Absicht, Moral und Druck nicht mehr aus. Es braucht eine Pädagogik und Kommunikation, die für unsere Lust auf Lebendigkeit attraktiv ist und den Zugang zum Flow nicht verschüttet. Eine solche Pädagogik hilft, sich an neues Denken zu gewöhnen, die persönliche Haltung mit einer neuen Ausrichtung zu verbinden, und sie trainiert die konkrete Umsetzung.
Ein Flow-Praktiker sieht in jeder Situation die Chance für ein Mehr an Bewusstheit und Lebendigkeit. Ganz besonders bei Krisen, denn da sind Engagement und Energie der Beteiligten besonders hoch. Er sieht die Krise als Ruf, etwas Besseres daraus zu machen. Genauso beim Charakter der Menschen. Eine Flow-Praktikerin hört beispielsweise den Ruf hinter einem Wutausbruch und sieht das tiefere Anliegen hinter engstirnigem Beharren. Bekommen Ruf und Anliegen, was sie brauchen, verschwinden die «Symptome» verlässlich.
«Symptome» unserer Zeit sind beispielswiese übermässiger Konsum, Bequemlichkeit und der Wunsch nach absoluter Sicherheit. Um dem eigentlichen Lebensanliegen hinter diesem Verhalten gerecht zu werden, ist es nötig, dass wir alle zu Pädagogen des Lebens-Flows werden! Unser aller Aufgabe ist es, beim andern den Flow der Lebendigkeit zu wecken und ihm zu geben, was er wirklich braucht, nämlich Herzlichkeit und nicht noch mehr Komfort. Flow-PraktikerInnen ist es eine Lust, Kreisläufe der Grosszügigkeit in Gang zu setzen. Sie wandeln Kreisläufe von Druck und Widerstand in Kreisläufe von Geben und Empfangen.
Ursprüngliche Verantwortung auch in herausfordernden Situationen wahrzunehmen, ist keine Last, sondern Teil einer neuen Lebenskunst.
___________________
Dr. Dr. Johannes Gasser (71), ist Leiter der Dr. Gasser Flow-Akademie und emeritierter Privatdozent der Uni Freiburg. Als promovierter Philosoph und klinischer Psychologe forscht er seit über vierzig Jahren im Bereich der Ursprünglichkeit und der vitalen Energien. Er entwickelte die Flow-Kommunikation mit ihren praktischen Werkzeugen und entdeckte, dass deren Grundsätze mit den alten daoistischen Prinzipien, deren Energiepraxis und mit den chinesischen Stratagemen übereinstimmen. Heute arbeitet er als Seminarleiter, Coach und Ausbilder von Flow-PraktikerInnen und Flow-TrainerInnen. www.flow-akademie.ch
Weiterführende Lektüre
1 Philip Zimbardo: Der Luzifer-Effekt. Die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. 2012, Springer-Spektrum, Fr. 27.90 / € 16.95
Johannes Gasser: Gesund und mehr... Von der Erziehung zum Bewusstsein, vom Wohlbefinden zur Vitalität. Gesammelte Aufsätze. 2006, Eigenverlag Flow-Akademie.ch, 56 S., Fr. 10.- / € 8.30
Mihaly Csikszentmihalyi: Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen. 1985, Klett-Cotta, 254 S., Fr. 39.90 / € 25.95
Monty Roberts: Der mit den Pferden spricht. 1997, Gustav Lübbe Verlag, 383 S., Fr. 19.90 / € 9.90