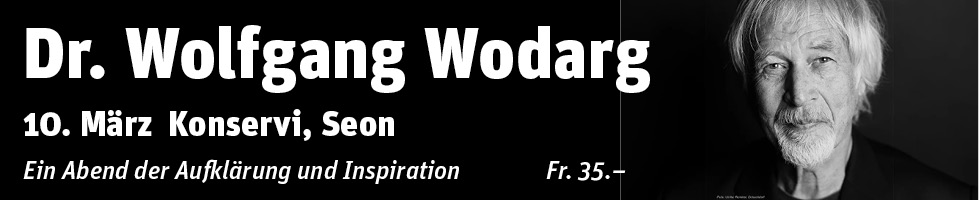In der Nacht auf den 15. Mai 1974, vor 50 Jahren, überquerten drei palästinensische Terroristen die israelische Nordgrenze und erreichten am Morgen den Ort Ma’alot, wo sie zunächst ein junges Paar und ihr Kind töteten, um danach in eine Schulsiedlung einzudringen und 115 Jugendliche und deren Lehrer als Geiseln zu nehmen. Sie sicherten das Gebäude mit Sprengfallen, die bei einem Befreiungsversuch israelischer Spezialeinheiten alle gleichzeitig explodieren würden.
Die Terroristen - manche nannten sie Freiheitskämpfer - forderten darauf die Freilassung von 23 Palästinensern aus israelischer Haft. Andernfalls würde das Schulgebäude gesprengt. Statt die Forderung zu erfüllen und so das Leben der Geiseln zu retten, versuchte das Militär die Eingeschlossenen zu befreien, worauf die Palästinenser die Sprengfallen zündeten. Dabei kamen 16 der Geiseln ums Leben, und weitere 70 wurden teils schwer verletzt. Die drei Angreifer wurden erschossen.
Die Presse berichtete fettgedruckt über den blutigen Terroranschlag, und das Entsetzen über den brutalen Tod so vieler Jugendlicher war gross. Auch ich las die Berichte, und auch ich war empört. Doch meine Empörung richtete sich vor allem gegen die Einseitigkeit der Berichterstattung. Denn schon seit längerer Zeit verfolgte ich nicht nur die weitere Entwicklung in Nordirland mit Spannung und Anteilnahme, sondern auch den Palästina-Konflikt. Mein in Belfast und Derry erwachtes Empfinden für Ungerechtigkeit fand in der Not und im Schicksal der Palästinenser ebenso reiche Nahrung. Je mehr ich über die Lage dieses geschundenen Volkes erfuhr – geschunden von einem anderen, noch viel mehr gepeinigten Volk –, umso grösser wurde mein Mitgefühl und meine Verbundenheit mit den Palästinensern.
Der Staat Israel als Heimat der Juden aus aller Welt hatte damals auch in der jungen Generation noch ein weitgehend unbeschädigtes Ansehen. Scharen von idealistischen jungen Leuten aus den westlichen Ländern pilgerten in den 68er-Jahren nach Israel, um in den sozialistisch organisierten Kibbuzim mitzuarbeiten und Jaffa-Orangen zu pflücken. Doch der Sechstagekrieg 1967, der Hunderttausende von Palästinensern ihres Landes beraubte und in die Flucht zwang, verdüsterte das Bild des Gelobten Landes. Die Neue Linke solidarisierte sich mit dem geknechteten Volk und unterstützte die Palästinenser in ihrem Kampf um ihr gestohlenes Land.
Auch die Berichterstattung der Medien wurde israel-kritischer. Doch bei Terroranschlägen der Palästinenser hörte jedes Verständnis auf. Das fand ich nicht richtig. Wenige Tage nach den Schlagzeilen von Ma’alot druckte die Basler «National-Zeitung» eine Leserzuschrift von mir.
Unter dem Titel «Und die Palästinenser?» schrieb ich:
Wenn Israeli bei einem palästinensischen Anschlag getötet werden, schlachtet das die Presse breit bei uns aus und schildert in düstersten Farben das Leid der unschuldigen Zivilbevölkerung. Im umgekehrten Falle begnügen sich unsere Zeitungen mit der üblichen Berichterstattung. Nachdem ihre Forderungen nicht erfüllt wurden, töteten drei junge Palästinenser in Ma’alot 16 Menschen und verletzten deren 70. Am Tag darauf bombardierten die Israeli zur Strafe ein palästinensisches Flüchtlingslager, mordeten 27 und verletzten 138 Menschen. Sie zerstörten das letzte Zuhause, das den palästinensischen Flüchtlingen noch geblieben war und machten damit wieder zahllose Menschen obdachlos. Ist dieser Racheakt etwa weniger schlimm?
Die Palästinenser kämpfen – beinahe ignoriert von der übrigen Welt – seit Jahrzehnten für ihre Heimat, ihre Freiheit und eine menschenwürdige Existenz. Die Israeli ‚kämpfen‘ mit Unterstützung der Großmacht USA und des internationalen jüdischen Kapitals gegen diese Befreiungsbewegung und weichen keinen Zoll von ihren Grenzen zurück, die sie eigenmächtig ausgedehnt haben. Nicht Israel ist der mutige kleine David, sondern die Palästinenser, die in ihrem Kampf allein stehen, da sie nicht einmal die Unterstützung durch die arabischen Länder erfahren. Israel repräsentiert im Nahen Osten den Koloss Goliath, und ich verstehe die Verbitterung der heimatlosen jungen Palästinenser, ich verstehe, dass ihnen heute fast keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als ihren Kampf mit diesen radikalen Mitteln zu führen, um die Weltöffentlichkeit aufmerksam zu machen. Im Nahen Osten wird kein Frieden herrschen, solange man dem palästinensischen Volk nicht zu seinem Recht verhilft.
Wie immer – und im Grunde bin ich heute noch so – machte ich mir keine Gedanken darüber, in welches Wespennest meine Zuschrift geraten würde und ob es daher vielleicht ratsam wäre, meine Wortwahl zu mässigen. Ich schrieb, was ich glaubte, schreiben zu müssen, und war erstaunt wie heftig das Echo ausfiel. Allein fünf Antworten wurden auf der Leserbriefseite veröffentlicht, weitere Briefe erhielt ich per Post und sogar am Telefon beschimpfte man mich.
Die Leserbriefschreiber stellten sich ausnahmslos hinter Israel und verurteilten meine Haltung. Ein Arzt aus Basel bezeichnete mich als Antisemit und wünschte mir wörtlich «gute Besserung», und auch die Sektion Basel der Gesellschaft Schweiz-Israel äusserte sich entrüstet. In ihrem Schreiben an mich, mit Kopie an die Redaktion, hiess es: «Auf Ihren Leserbrief hin erhielten wir zahlreiche telefonische Anrufe. Die Anrufer zeigten sich alle darüber bestürzt, dass ein Schweizer Bürger die Morde von Ma’alot gutheisst».
Ich hatte die Morde an den israelischen Jugendlichen keineswegs gutgeheissen. Doch es wurde zu Recht bemerkt, dass die Palästinenser in meinem Vokabular lediglich «töteten», während die Israeli «mordeten», und dass ich von «Menschen» schrieb, nicht von «Schülern». Ich hatte die Worte bewusst so gewählt. Das würde ich heute nicht mehr tun. Ich würde heute auch meine Betroffenheit darüber zeigen, dass so viele Jugendliche, die keine Schuld trifft, in Ma’alot sterben mussten. Aber ich müsste im gleichen Atemzug an die zahllosen palästinensischen Kinder denken, die den Vergeltungsschlägen der Israeli damals und später zum Opfer fielen.
Vor allem aber stelle ich mit viel grösserer Betroffenheit fest, dass mein anklagender, im Tonfall jugendlicher Empörung gehaltener Leserbrief noch immer so aktuell ist wie damals. Welches schreiende Unrecht auf dieser Welt ist nach einem halben Jahrhundert noch immer nicht überwunden, sondern tönt heute noch lauter, noch verzweifelter in unseren Ohren?
Vor 50 Jahren war ich begeistert vom Sozialismus. Heute bin ich es nicht mehr. Das Leben hat mich gelehrt, dass ein neues Gesellschaftssystem nie eine Lösung ist. Das Zusammenleben der Menschen muss sich organisch entwickeln. Ich empfinde mich deshalb als lernfähig. Bei Palästina jedoch habe ich nicht dazulernen müssen. Wenn Menschen nicht frei sind, wenn sich ein Volk nicht in Selbstbestimmung entfalten darf, hat mich das immer schon aufgewühlt und bewegt. Und es erfüllt mich auch mit bescheidenem Stolz, dass ich seit fünfzig Jahren in Wort und Schrift immer wieder gegen das Leid der Palästinenser angekämpft habe. Und ich habe dafür meistens kritische israelische Quellen verwendet.
Warum aber schickte ich meinen Leserbrief nicht dem Tages-Anzeiger, sondern der Zeitung in Basel? Eine plausible Erklärung wäre gewesen, dass Leserbriefe nur von Lesern geschrieben werden. Mitarbeiter machen das nicht. Doch darin lag nicht der wahre Grund, weshalb ich für meine Zuschrift auf die National-Zeitung auswich…
***
Einen knappen Monat davor war auf der Jugendseite des Tages-Anzeigers mein Bericht über ein neugegründetes «Forum Jugend und Armee» abgedruckt worden. Als Gegengewicht zu den militärkritischen Soldatenkomitees sah das «FJA» seine Aufgabe darin, bei Soldaten und anderen jungen Erwachsenen für eine starke Armee zu werben. Da ich selber immer noch im Zürcher Soldatenkomitee aktiv war, schlug ich dem Tagesanzeiger ein Porträt des Forums vor. Ein kritisches Porträt natürlich, das mir Gelegenheit geben würde, auch die Soldatenkomitees zu erwähnen.
Ich selber hatte schon vor dem Schreiben meines Berichts eine erste Begegnung mit den Jungoffizieren gehabt, die zu den Aktivisten des Forums gehörten. An einem Sonntagabend hatte ich mich zusammen mit einer jungen Frau, die gelegentlich bei uns mitmachte, vor die Kaserne Zürich begeben, um den Rekruten Flugblätter zu verteilen, die sie auf ihre Rechte aufmerksam machen sollten. Doch als wir ankamen, standen vor dem Kaserneneingang zwei junge Männer und händigten den Soldaten ihrerseits Flugblätter aus. Das konnten nur Leute vom neugegründeten promilitärischen «Forum» sein.
Wir liessen uns von ihnen nicht stören, stellten uns ebenfalls in die Nähe des Tors und begannen mit unserer Agitation. Dabei machten wir eine interessante Erfahrung: An anderen Abenden trat aus der Kaserne jedesmal die Militärpolizei und wollte unsere Personalien sehen. Manchmal kam es auch vor, dass sie uns sogar wegzuschicken versuchte.
An diesem Abend jedoch blieben wir völlig unbehelligt. Die Erklärung lag auf der Hand: Weil die Jungoffiziere ihre Pamphlete selbstverständlich unbehindert verteilen durften, musste man ausnahmsweise auch uns tolerieren.
Ich vereinbarte ein Gespräch mit Martin Raeber von der Zürcher Sektion des FJA. Raeber, ein Mitbegründer des Forums, war Student und schrieb gelegentlich für die NZZ. Er wohnte in Birmensdorf. Am Telefon stellte ich mich ihm gegenüber als freischaffender Journalist vor. Dass ich auch für den «focus» schrieb, war ihm vermutlich bekannt. Aber mein Angebot, seine Vereinigung im Tagesanzeiger zu porträtieren, konnte er im eigenen Interesse nicht ablehnen. Deshalb sagte er zu.
Birmensdorf befand sich von der Waldegg aus betrachtet gleich um die Ecke. Ich fuhr mit dem Velo hin, es war ein sonniger Tag im April, und ich sehe das Haus sogar immer noch vor mir, wo der Armeebefürworter wohnte. Raeber war gross, gut gebaut, mit sauber rasiertem Bart und markantem Blick. Der geborene Offizier, so kam er mir vor.
Er bat mich herein, und wir setzten uns an den Küchentisch. Dass wir das steife «Sie» beibehielten, empfand ich als unnatürlich. Raeber war nicht viel älter als ich, vielleicht Mitte 20, doch er wirkte auf mich bereits wie ein etablierter Erwachsener. Beide verhielten wir uns neutral und sachlich – wie Menschen, die mehr voneinander wissen, als sie zugeben wollen. Ich fragte ihn nach den Zielen und Aktivitäten des Forums, und er gab mir bereitwillig Antwort. Das Gespräch wurde rasch kontrovers, weil meine Fragen kritische Fragen waren. Aber ich bemühte mich, journalistische Haltung zu wahren.
Dann verliess der junge Armeepropagandist die Küche für einen Moment und ich sah mir den kleinen Notizzettel an, den er, etwas versteckt, neben sich liegen gelassen hatte. Als ich las, was da in flüchtiger Handschrift geschrieben stand, schlug mein Herz plötzlich schneller. Es waren lauter Informationen über meine Person: Dass ich in einer «Kommune» wohnte, für das «linksradikale» Heft «focus» schrieb, in Nordirland mit «IRA-Terroristen» Kontakt gehabt hatte – und dass ich «Mitglied des Soldatenkomitees» war.
Meine Mitgliedschaft hatte ich öffentlich nie bekundet. Woher also hatte er diese Information?
Da hörte ich Raeber in die Küche zurückkommen. Schnell liess ich den Zettel in meiner Tasche verschwinden. Der Jungoffizier setzte sich wieder und schien nichts bemerkt zu haben. Während des ganzen restlichen Interviews sass ich auf Nadeln. Ständig erwartete ich, dass seine Augen den Zettel suchten. Doch er schien ihn vergessen zu haben.
Etwas übereilig verliess ich Raeber. Glücklicherweise beharrte er nicht darauf, den Text vor dem Erscheinen lesen zu dürfen. Das gab mir freieres Spiel, unser Gespräch so zu verwerten, dass das «Forum Jugend und Armee» nicht allzu positiv wegkam. Wir gaben uns freundlich die Hand zum Abschied – und hatten immerhin soviel gemeinsam, dass wir es beide nicht freundlich meinten.
Erst zurück auf der Waldegg wagte ich es, den Zettel wieder hervorzunehmen. Er bewies schwarz auf weiss, dass der FJA-Präsident sein Wissen aus einer Quelle bezog, die nicht öffentlich war. Möglicherweise aus dem Archiv des «Subversivenjägers» Cincera, den ich in dieser Chronik bereits erwähnt habe. Oder direkt von der Polizei.
Mitten in meine Gedanken hinein, wie ich den Zettel verwenden konnte, läutete es. Ich erschrak. Niemand läutete an der Haustür, ausser der Pöstler am Vormittag. Als ich öffnete, stand vor mir ein Polizeibeamter. Ohne grosse Vorrede kam er zur Sache.
«Sie haben ein Dokument entwendet», erklärte er schroff. Und er verlangte dessen Herausgabe.
Es gibt Momente im Leben, wo keine Zeit zum Nachdenken bleibt. Doch was tat ich? Eingeschüchtert von der Autorität des Beamten, rückte ich das Beweisstück heraus. Er verliess mich, zufrieden, seinen Auftrag erfüllt zu haben – während ich mich nicht wiedererkannte. Warum war es ihm gelungen, mir Angst einzujagen? Von einem Zettel wisse ich nichts, hätte ich antworten müssen. Meinen Ärger über mich selbst wurde ich nicht so schnell wieder los – obwohl ich, realistisch betrachtet, gar nichts anderes hätte tun können. Der Polizist hätte sich nicht abwimmeln lassen. Vielleicht hätte er mich sogar mitgenommen. Doch der Überraschungseffekt hatte genügt. Der Zettel befand sich nicht mehr in meiner Hand.
Um so kritischer fiel mein Porträt des Armeevereins aus. Ich zog alle Register, um das Forum in einem schlechten Licht darzustellen. Auf diese Weise konnte ich mich vor mir selbst wieder blicken lassen. Martin Raeber würde keine Freude haben.
Der Bericht erschien, und einige Tage vergingen. Und dann geschah es. Das Telefon läutete. Da sich ausser mir niemand im Haus befand, nahm ich selber ab. Nichts Böses ahnend nannte ich meinen Namen.
«Walter Stutzer am Apparat», tönte es am anderen Ende der Leitung.
Walter Stutzer. Das war der Chefredaktor.
Es habe Reklamationen gegeben nach meinem Porträt. Beanstandet worden sei nicht nur die Einseitigkeit des Artikels, sondern vor allem der Umstand, dass ich Unterlagen entwendet hätte.
«Mir liegt ein Polizeibericht vor», sagte der Chefredaktor. «Solche unlauteren Methoden haben in unserem Haus nichts zu suchen.» Die Redaktion habe mir immer viel Wohlwollen dargebracht. Aber eine solche Entgleisung könne er als Chefredaktor nicht dulden.
Ich glaube mich zu erinnern, dass er einen Augenblick innehielt. Dann fuhr er fort – und es klang, als fiele es ihm nicht leicht, dies zu sagen: «Auf Ihre Mitarbeit müssen wir deshalb in Zukunft leider verzichten.»
Wie unser Telefongespräch weiterging, daran habe ich keine Erinnerung. Aber ich glaube, ich war noch imstande zu fragen, bis wann das Schreibverbot gelte.
«Das kann ich Ihnen nicht sagen. Bis auf weiteres jedenfalls.»
Unbefristet, mit anderen Worten. Die Türe des Tages Anzeigers war zu. Das war der Grund, warum mein Leserbrief nicht in Zürich, sondern in Basel erschien.
Nächste Folge am 15. September