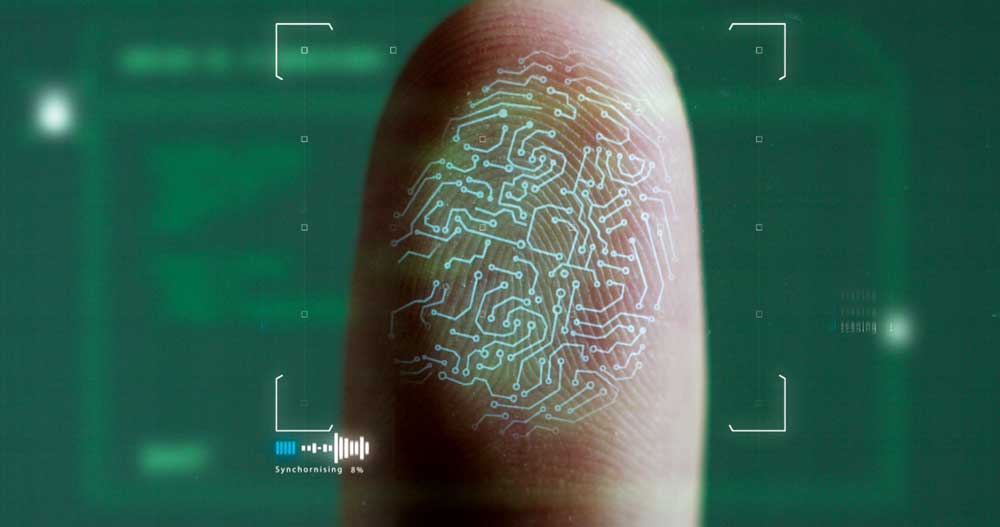Es beginnt harmlos: Wer im Internet einkauft, erhält eine Bestätigung mit Vorschlägen, was ihm auch noch gefallen könnte, basierend auf den getätigten Einkäufen. Es ist dies die allereinfachste Form der Datenauswertung, wie sie Verkäufer seit Jahrtausenden praktizieren.
Aus öffentlich zugänglichen Daten entstehen unterschwellige Manipulationen. Und die sind für den Anwender nicht einmal unangenehm.
Nur sind unsere Beziehungen im Internet nicht nur solche zwischen Kunden und Lieferanten, sondern zwischen allen und allem. Und immer hinterlassen wir eine Datenspur – wenn wir telefonieren, mailen, liken, surfen, bezahlen oder posten. 500 MB Daten pro Erdbewohner und Jahr wurden 2012 nach Angaben des Datenwissenschaftlers Michal Kosinski von der Stanford Graduate School of Business abgesogen und gespeichert. 2025 wird es die unvorstellbare Menge von 62 GB pro Person sein, mit der die Vorhersagemaschinen gefüttert werden, die unsere Entscheidungen kennen, bevor wir sie getroffen haben. Gerade mal 250 Likes auf Facebook genügen zur Erstellung eines Persönlichkeitsprofils, das präziser ist als das eines Ehepartners. Aus Fahrten von Uber lässt sich herauslesen, wer eine Affäre hat und die Einkäufe im Supermarkt verraten eine frühe Schwangerschaft. Die Verbindung von Datenbanken mit an sich unerheblichen und quasi öffentlichen Mikro-Informationen erlaubt in der Analyse intimste Rückschlüsse.
Mit grösster Gedankenlosigkeit verwenden wir die Dienste von Google, Facebook und anderen Datenkraken in der irrigen Vorstellung, wir seien ihre Kunden. Aber wir sind das Produkt. Deshalb erhalten wir auch keine Rechnung und deshalb gibt es einen Kundendienst nur für die Firmen, die Werbung schalten und ihre Daten kaufen.
Auch viele Kleine sind im Geschäft: Bereits 2013 enthielten mehr als 42 000 der auf Google erhältlichen Apps Spyware und Trojaner zur versteckten Datensammlung, wie der in über 70 Ländern tätige Cyber-Kriminalist Marc Goodman in seinem Bestseller «Future Crimes» (Anchor Books, 2015) schreibt.
Wenn wir Dokumente auf Google oder Instagram hochladen, übertragen wir den Betreibern explizit die Nutzungsrechte. Falls Sie das nicht gewusst haben, haben Sie vermutlich die Allg. Geschäftsbedingungen nicht gelesen, deren Lektüre den durchschnittlichen US-Anwender übrigens rund 76 Tage pro Jahr kosten würde. «Wir haben es zugelassen», schreibt Goodman, «dass wir monetisiert und zu billigen Produkten gemacht wurden und Milliarden von Dollars an eine Elite weggegeben haben, die die Chance erkannt und genutzt hat.»
Natürlich werden wir immer wieder auf die Gefahren der leichtsinnigen Weitergabe von Daten hingewiesen. Überlegen Sie sich bitte vor dem Weiterlesen, wie lange solche Warnungen im Durchschnitt wirken. – Das wollte nämlich auch der Verhaltensökonom Alessandro Acquisti von der Carnegie Mellon University wissen und entwickelte einen Test. Die Forscher gaben Studenten einen elektronischen Fragebogen, in dem sie u.a. angeben sollten, ob sie bei Prüfungen auch schon mal gemogelt haben. Die eine Gruppe erhielt dazu den Hinweis, dass nur Komilitonen die Resultate zu Gesicht bekämen; die Ergebnisse der anderen Gruppe würden auch den Professoren zur Verfügung gestellt. Logischerweise wichen die Resultate der ersten Gruppe wesentlich von denjenigen der zweiten ab.
Dann wiederholten die Forscher den Test und platzierten den Hinweis in unterschiedlichen zeitlichen Abständen vor der kritischen Frage nach der Prüfungsehrlichkeit. Welche zeitliche Verzögerung der Warnung ergab bei den beiden Gruppen identische Resultate? Es sind bedenkliche 15 Sekunden!
Die Ökonomie spielt bei der Sorglosigkeit die entscheidende Rolle, mit der wir uns den Datenstaubsaugern der sog. sozialen Medien hingeben. Aus Sicht der Betreiber ist Facebook kein Service zur Pflege von Freundschaften, sondern ein gigantisches Marktforschungswerkzeug, in dem 2,23 Mrd. «Monthly Active Users» unaufgefordert persönliche und zum Teil intime Informationen preisgeben, mit Namen und oft mit Fotos und auch über Menschen, die gar keinen Facebook-Account haben.
Aus Sicht der Betreiber ist Facebook kein Service zur Pflege von Freundschaften, sondern ein gigantisches Marktforschungswerkzeug
Diese unstrukturierten Daten werden dann innert Sekunden mithilfe von Algorithmen zu hochpräzisen Persönlichkeitsprofilen kondensiert und versteigert. Sie sind so zuverlässig, dass sich Banken bei der Bonitätsprüfung auf sie verlassen. Damit lässt sich auch unwiderstehliche, personalisierte Werbung erstellen. Nur ein Beispiel, das technisch bereits möglich ist: Anstatt dass Ihnen irgendein Promi in der Werbung ein Produkt unterjubelt, kommt die Empfehlung von einer Kunstfigur aus den Gesichtern Ihrer beiden liebsten Freunde Ihres Facebook-Accounts. Der Betrachter kann die beiden ursprünglichen Gesichter nicht mehr erkennen, aber er findet die Synthese sympathisch und glaubwürdig. So entstehen aus öffentlich zugänglichen Daten geheime Botschaften und unterschwellige Manipulationen.
Und die sind für den durchschnittlichen Anwender (vorderhand) nicht einmal unangenehm: Er erhält vor allem Werbung, und zwar für Dinge, die ihn interessieren. Wenn Sie sich auf einer Website für ein Produkt oder eine Reisedestination interessieren, wird Ihre IP-Adresse mit dem entsprechenden Merkmal gespeichert und an Datenbroker verkauft, die ganze Pakete mit ähnlichen Merkmalen versteigern. Der Meistbietende kann dann den Adressen eine passende Werbung auf den Rechner spielen. Der Vorgang dauert nicht Wochen, nicht Tage oder Stunden, sondern wenige Sekunden.
Wertfrei betrachtet, ist das ziemlich genial. Aber auf der kollektiven Ebene auch brandgefährlich: Zum Einen leben immer mehr Menschen in einer Blase, in einer von Algorithmen definierten virtuellen Wirklichkeit. Und zum anderen wird diese Wirklichkeit von den Konzernen hergestellt, die über die nötigen Ressourcen verfügen und die nach Gewinn und nicht nach Erweiterung der individuellen Freiheiten oder nach Weltverbesserung streben. Unsere Gesellschaft wandelt sich also immer mehr von einer demokratisch organisierten Gemeinschaft freier Menschen, die sie zu sein wünscht, in eine Herde von Konsumvieh, für die Politik bestenfalls noch aus dem besteht, was gerade gehypt wird. Sie denkt und tut, was Algorithmen ihr sagen. Brauchen solche Menschen überhaupt noch eine Privatsphäre?
Damit sind wir bei einem rechtlich unscharfen und historisch jungen Rechtskonzept angelangt, das zwar die meisten Nutzer vehement befürworten, aber ebenso leichtsinnig hergeben. Sie spielen lieber umsonst auf ihrem Handy «Angry Birds» und geben dafür die Kontaktdaten ihres Beziehungsnetzes her, um nur ein Beispiel zu nennen.
Unsere Gesellschaft wandelt sich von einer demokratisch organisierten Gemeinschaft in eine Herde von Konsumvieh, für die Politik noch aus dem besteht, was gerade gehypt wird.
Eine eigentliche Privatsphäre gab es weder im Altertum noch im Mittelalter. Sie wurde erst mit Thomas Hobbes und seinem grundlegenden staatstheoretischen Werk «Leviathan» (erschienen 1682) und seinen Nachfolgern entwickelt. Basis der liberalen Demokratien ist die Freiheit des Individuums, die der Staat nur mit demokratischer Legitimation beschneiden darf – was nicht verboten ist, ist erlaubt. Verwirklicht wurde dieses Ideal nur in Ansätzen. Die Menschheit ist für so viel Freiheit und die Macht für so viel Selbstbeschränkung offenbar noch nicht reif. Die Privatsphäre ist zwar völkerrechtlich geschützt, u.a. durch die Europäische Menschenrechtskonvention, aber rechtlich wirksam im Big Data-Universum ist das nicht.
Die Politik wird heute von realen und vermeintlichen Risiken bestimmt, die es zu verhindern gilt, und zwar nicht nur mit Gesetzen, sondern auch durch Selbstdisziplin und Verhaltensnormen. Je mehr Menschen auf der Erde leben, je mehr Platz sie durch ihre gesteigerte Mobilität brauchen und je grösser ihr ökologischer Fussabdruck wird, desto stärker ist das Gemeinwohl vom individuellen Verhalten abhängig. Was liegt für eine Regierung näher, als das Verhalten ihrer Bürger zu erfassen und zu beeinflussen. Wenn der Staat für Bürger in Altersarmut sorgen muss, wird er geeignete Wege finden wollen, sie vorher vor exzessivem Geldausgeben zu schützen. Wenn die Allgemeinheit für die Krankheitskosten aufkommt, wird sie auch dafür sorgen, dass wir gesund leben. «In diesem sozio-technischen System ist umfassende soziale Kontrolle möglich und notwendig», schreibt Maximilian Hotter in «Privatsphäre – der Wandel eines liberalen Rechts im Zeitalter des Internet» (Campus, 2011). Der Staat müsse «sich regelrecht die Augen verbinden, um den Freiheitsansprüchen seiner Bürger gerecht zu werden».
Der Trend ist also klar: Je mehr Daten gesammelt werden, desto mehr Risiken können erfasst und durch Eingriffe in die Privatsphäre auch vermindert werden. Es könnte aber auch sein, dass diese Rechnung nicht aufgeht und Benjamin Franklin mit seinem berühmten Wort recht behält: «Wer grundlegende Freiheit aufgibt, um ein bisschen temporäre Sicherheit zu kaufen, verdient weder das eine noch das andere.»
Was der Verlust der Privatsphäre bedeutet, können wir erst erahnen. Sie ist in dieser Hinsicht mit der Gesundheit vergleichbar: Wir schätzen sie erst, wenn sie uns fehlt.
Die meisten Menschen verhalten sich unterschiedlich, je nachdem ob sie sich im öffentlichen oder im privaten Raum bewegen. Ich zum Beispiel spreche gerne laut mit mir selber, wenn ich schreibe und besonderen Wert auf geschmeidige Sätze lege. Im Café würde ich das nie tun. Ich würde es vermutlich auch nicht tun, wenn ich wüsste, dass jemand über das Mikrophon meines Rechners mithört.
Der damalige Google-Chef Eric Schmidt brachte es 2009 auf den Punkt: «Wenn es etwas gibt, von dem du nicht willst, dass es jedermann weiss, dann solltest du es vielleicht gar nicht tun.» Mit anderen Worten: Wir sollen uns so verhalten, als stünden wir unter ständiger Beobachtung.
Im öffentlichen Raum lassen sich zwei grundlegend verschiedene Verhaltensweisen beobachten. Die einen sind eher zurückhaltender als sonst, die anderen schieben ihr Ego für alle sichtbar vor sich her. Ich vermute, dass sich diese Unterschiede in einer Welt unter dauernder Beobachtung akzentuieren, frei nach dem Motto «Ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert». Die einen werden vorsichtiger wie Automobilisten hinter einem Polizeifahrzeug, die anderen setzen noch einen drauf wie eine Horde betrunkener Rekruten.
Das Individuum, den unverwechselbaren einzelnen Menschen, wird es unter diesen Umständen wohl nicht mehr lange geben. Wenn wir in die Zukunft der Individualität schauen wollen, müssen wir ausnahmsweise nicht nach Amerika blicken, sondern nach China. Dort wird gerade ein System eingeführt, das die Bürger per Gesichtserkennung einer umfassenden Sozialkontrolle unterzieht. Bei Rot die Strasse zu überqueren hat einen Abzug auf dem Punktekonto und Nachteile beim Buchen von Reisen, bei der Jobsuche oder sonstwie im Alltag zur Folge.
Ein komplettes Chaos – der Zustand, in dem nicht mehr klar ist, wer wer ist. Und in dem auch die Besitzer gesicherter Identitäten kein eigenständiges Leben mehr führen können.
Ein Grossexperiment in digitaler Bevölkerungskontrolle mit 1,2 Mrd. Versuchspersonen läuft bereits seit zwei Jahren in Indien. Ein Bankkonto und selbst Essenszuschüsse vom Staat gibt es dort nur gegen Hinterlegung biometrischer Daten wie Fingerabdrücke und Iris-Scans. Die grosse Datenbank, in der all die Informationen gespeichert sind, ist natürlich längst gehackt, und falsche Identitäten gibt es nicht nur im Darknet, sondern auch im normal zugänglichen Netz, wie das erste Deutsche Fernsehen am 6. August in seiner Doku «Pässe für Kriminelle» festgestellt hat.
Identitätsdiebstahl nimmt rasant zu. Das Problem: Während man bei einer gehackten Datenbank ein neues Passwort setzen oder eine geklaute Kreditkartennummer aus dem Verkehr ziehen kann, gibt es bei gestohlenen biometrischen Daten keine Remedur. Künstliche Fingerkuppen – auf dem Markt erhältlich – sind keine Lösung und eine neue Iris – rund 2500 Euro pro Auge – auch nicht. Immer wird jemand anders mit meiner Identität Unfug treiben können. Und bis ans Lebensende werde ich beweisen müssen, der zu sein, der ich bin und nicht der, der ich aufgrund der Daten sein sollte. Man müsse sich bewusst sein, dass solche Datenbanken nicht hundertprozentig geschützt werden könnten und ein Leck ein «komplettes Chaos auslösen» könne, sagt der deutsche Cyber-Sicherheitsexperte Gunnar Porada. Ein komplettes Chaos – eine zutreffende Beschreibung für einen Zustand, in dem nicht mehr klar ist, wer wer ist. Und in dem auch die Besitzer rechtlich gesicherter Identitäten kein eigenständiges Leben mehr führen können.
China und Indien sind weit weg, werden Sie denken. Aber die Entwicklungen in der digitalen Welt laufen so schnell, dass die Fakten geschaffen sind, bevor sich eine Demokratie der Gefahren überhaupt bewusst, geschweige denn handlungsfähig werden kann. Die schöne neue Welt der totalen Kontrolle schleicht sich über Bezahlsysteme in unsere Ordnung ein, «absichtsvoll, systematisch und weltweit», wie der deutsche Wirtschaftsjournalist Norbert Häring in seinem neuen Buch «Schönes neues Geld» (Campus, 2018) überzeugend darlegt. «Dass die neuen digitalen Bezahlverfahren so viele Daten produzieren und so viele sensible Daten von uns verlangen, ist die Hauptattraktion für diejenigen, die sie einführen wollen», schreibt Häring. «Hier ziehen Regierungen, die ihre Bevölkerung überwachen möchten, mit Konzernen an einem Strang, die zuverlässige Daten haben wollen.» Das Ergebnis: «Alle Bequemlichkeit ist auf unserer Seite, alle Macht auf der anderen.»
Das alles sieht nicht besonders erfreulich aus. Dabei haben wir die Risiken des Internet der Dinge, der Cyberkriminalität und der Geheimdienste nicht einmal gestreift. Von der UNO, vom Staat und seinen Beamten werden wir wenig Hilfe erhalten. Selbst wenn sie wollten, werden sie zu langsam sein. Es bleibt also uns überlassen, für anständige Verschlüsselung zu sorgen, für das Bargeld einzustehen, in der digitalen Welt Zurückhaltung zu üben und ein möglichst freies, die Algorithmen verwirrendes Leben zu führen. Denn etwas wird auch die intelligenteste Maschine nie verstehen: Freiheit!
_________________
Mehr zum Thema «öffentlich | geheim» im Zeitpunkt 157