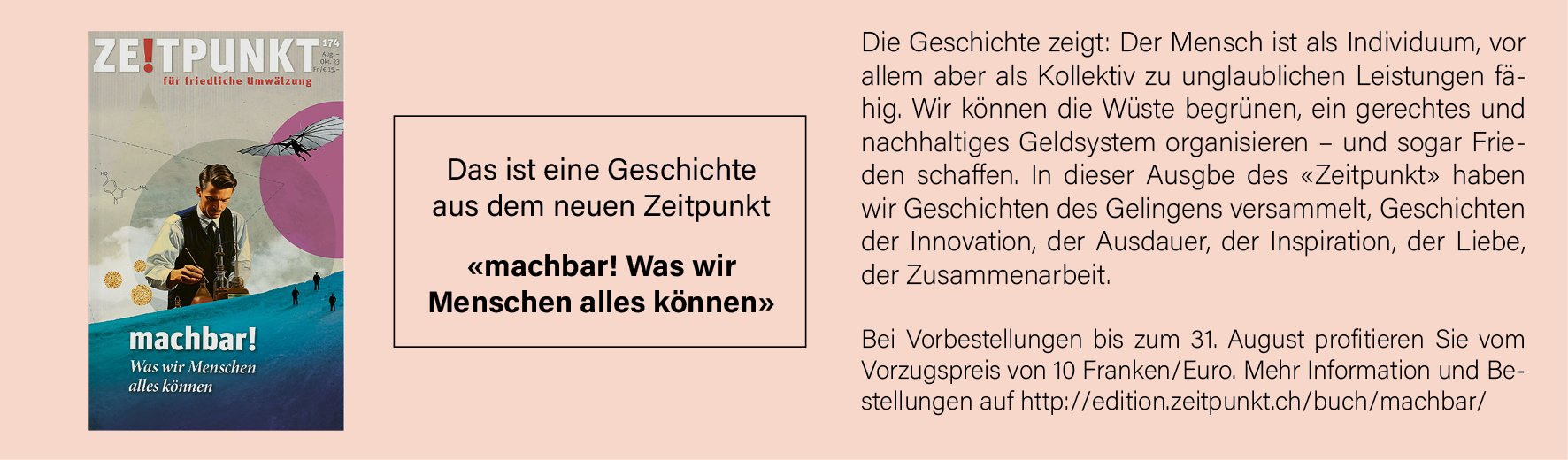
Am 39. Tag nach dem Absturz der kleinen Cessna sagt General Pedro Sánchez, der Kommandant des Suchtrupps, in einem Interview, er gibt noch nicht auf. Nur einen Tag später finden sie die Kinder – unterernährt, dehydriert, apathisch, voller Instektenstiche – aber sie leben und sind unverletzt. Weltweit überschlagen sich die Medien – die ganze Welt feiert das «Wunder».
Was ist ein Wunder? Vielleicht die Erfahrung von Menschen, die nicht aufgeben. Denn nicht nur der General und seine Truppen – auch die Kinder dachten gar nicht daran.
Die Geschwister – 13, 9, 4 und 1 Jahr alt – waren mit ihrer Mutter unterwegs zum Vater. Dieser war von einer Guerilla-Splittergruppe bedroht worden und deshalb in eine andere Stadt geflohen.
Es ist der 1. Mai, als die uralte Cessna abstürzt. Alle Erwachsenen sterben. Die Kinder hinten im Flugzeug der kopfüber in die Tiefe stürzenden Maschine bleiben unverletzt.
«Meine älteste Tochter hat mir gesagt, dass ihre Mutter noch vier Tage gelebt hat», sagte der Vater der Kinder später. «Bevor sie starb, hat sie vielleicht gesagt: Geht.»
Die Geschwister gehen los. Aber wohin? Es regnet – bis zu 16 Stunden am Tag. Sie können höchstens 20 Meter weit sehen. Nachts wird es stockdunkel. Viele Pflanzen sind giftig. Schlangen und Wildkatzen streifen im Wald umher. Und manchmal auch menschliche Raubtiere: Drogenschmuggler und Guerilla. (Zwar hat sich nach den Friedensabkommen der Regierung mit der FARC die Sicherheitslage in Kolumbien verbessert. Allerdings werden noch immer Teile des Landes von illegalen Gruppen kontrolliert.)
Die Geschwister haben kaum etwas zu essen, Insekten plagen sie, sie kennen den Weg nicht. Doch sie kennen den Dschungel: Sie sind Huitoto-Indianer und in einer ähnlichen Umgebung aufgewachsen. Das macht den ganzen Unterschied.
Was die Medien ein Wunder nannten, war in Wirklichkeit der Triumph indigenen Wissens.
Die beiden Älteren, Lesly und Soleiny, lassen die beiden Jüngeren, Tien und Cristin, keinen Moment aus den Augen. Sie ernähren sich zuerst von einem Sack Maniokmehl aus dem Flugzeug, dann von Samen und Früchten.
Sie bauen Unterschlüpfe aus Blättern und Ästen, um sich vor dem Dauerregen zu schützen. Sie bleiben immer in der Nähe eines Bachs und arbeiten sich flussabwärts vor. Sie achten auf die Gefahren: Schlangen, Spinnen, Kaimane – aber gegen die Insekten gibt es keinen Schutz. Und so werden sie schliesslich vom unnachgiebigen Suchtrupp gefunden. Vier westliche Kinder dieses Alters wären im Wald wahrscheinlich umgekommen.
Was die Medien ein Wunder nannten, war in Wirklichkeit der Triumph indigenen Wissens: Wie Indigene aller Regionen sind die Kinder in der Gewissheit des Kontinuums aufgewachsen – verbunden und genährt von Mutter Erde, in bewusster Co-Abhängigkeit zur Natur und auch untereinander.
Ein «Wunder» ist vielleicht das Zusammentreffen von zwei Dingen: Etwas Unerklärbares und etwas Erklärbares. Ein Stück göttlicher Gnade – und unsere Bereitschaft, sie anzunehmen.
Beim «Wunder von Lengede» 1963 wurden 14 Tage nach einem Grubenunglück die letzten 11 Kumpel lebend gerettet. Damals hiess es, der Glaube haben ihnen die Kraft zum Durchhalten gegeben. Ähnliches beim «Wunder von Thailand» 2018. Oder bei fast allen Erdbeben, wo Retter noch viele Tage weiterarbeiten, auch wenn Experten längst abwinken.
Oder wie die zwei Frösche, die in den Milcheimer fallen. Sagt der eine: Das ist das Ende, faltet seine Froschbeine ein und geht unter. Der andere weigert sich aufzugeben und strampelt verzweifelt. Und strampelt. Und strampelt. Bis die Milch zu Butter wird und er hinaushüpft.







