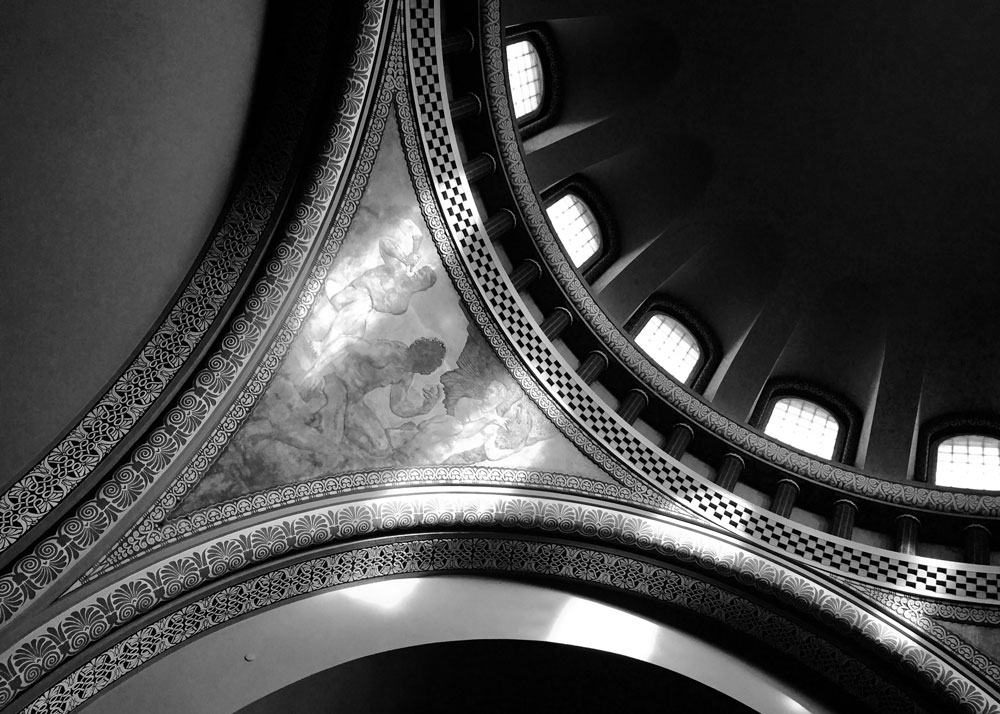Nachdem ich das Provisorium im Herbst mit Ach und Krach überwunden hatte, konnte ich mich im neuen Jahr wieder ohne schlechtes Gewissen meinen heimlichen Hauptbeschäftigungen widmen, zu denen die Schule nach Möglichkeit nicht gehörte. Ich verfasste meine Musikkolumne, gab mit Elias weitere Nummern des «manuskript» heraus, las inzwischen täglich die Zeitung und jedes Flugblatt, das ich in die Finger bekam – aber ich entwickelte gleichzeitig auch das Bedürfnis, über die sogenannt letzten Dinge zu sinnieren. Und wer mich inzwischen ein wenig kennt, kann sich denken, dass ich auch diesbezüglich sehr bald eine eigene Meinung hatte, die formuliert und öffentlich gemacht werden wollte.
Vor allem das Thema Religion forderte mich heraus. Als Kind protestantischer Eltern hatte ich alle Stationen reformierter Erziehung genossen, von der Sonntagsschule über die Kinderlehre bis zur Konfirmation, an der ich kein weisses Hemd mit Krawatte trug, sondern einen weissen Rollkragenpullover. Einen einzigen Mitschüler hatte ich dazu anstiften können, es mir gleichzutun. Alle anderen Knaben in unserer Klasse hielten sich brav an die Vorgabe ihrer Eltern.
Befriedigt über meine kleine Demonstration kehrte ich der Kirche danach entschieden den Rücken und besuchte höchstens noch die sporadischen Festchen im kirchlichen Jugendtreff, die mich aber eher frustrierten, weil sie mir nicht die Bekanntschaft mit einem Mädchen bescherten, in das ich mich endlich hätte verlieben können. Auch ein christliches Skilager zwischen Weihnachten und Neujahr 1971 brachte nicht den erhofften Erfolg.
Immerhin aber diskutierte ich eines Nachts draussen im Freien, bei empfindlichen Temperaturen mit einer Lagerteilnehmerin über Gott und die Weite des Universums, das sich in seiner ganzen nächtlichen Pracht über uns ausbreitete. Ich fand das Mädchen sehr nett und hatte auch nichts dagegen, mit ihr zusammen ein wenig zu frieren, doch ihr Glaube war mir entschieden zu wenig kritisch. Denn sie glaubte so frömmlerisch und naiv an Gott wie das Gretchen in Goethes «Faust». Wieder zu Hause, suchte ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Da sie keine höhere Schule besuchte, bezweifelte ich, ob sie mir intellektuell gewachsen sein würde.
Dass ich ihr nicht gewachsen sein könnte, fiel mir nicht ein.
Doch mein Interesse an Fragen des Glaubens war definitiv geweckt – und dies hatte zur Folge, dass ich mich einige Male am Sonntagmorgen ganz bewusst in die Kirche begab. Danach setzte ich mich an die Schreibmaschine und beschrieb in einem Leserbrief an den «Kirchenboten», die Zeitschrift der Reformierten, meine Eindrücke. Der Titel, den ich wählte, war reichlich pathetisch: «Mein Unbehagen mit eurem Gott».
«Ich habe mich im Gottesdienst nicht gelangweilt», begann ich. «Es war im Gegenteil lehrreich, wie sich meine Vorurteile bestätigten.» Die sonntäglichen Predigten, fand ich, würden stets nach dem gleichen Schema verlaufen: «Am Anfang steht eine biblische Geschichte, worauf der Pfarrer eine Parallele zur Gegenwart zieht. Dann verlangt das Problem nach Bewältigung, nach etwas, woran der Mensch sich festhalten kann. Das ist der Augenblick, wo Gott eingeführt wird: Gott als grosser Beschützer – eine Vorstellung, die der Gegenwart nicht mehr gerecht wird.»
«Denn viele Leute fragen sich heute: Wer ist Gott? Mit dem konventionellen Gottesbild können sie nichts anfangen. Die Kirche muss sich verändern, wenn sie nicht bloss noch die Sonntagsfreude von alten Leuten sein will. Nur ihnen schenkt die Predigt noch etwas Trost: Bete zu Gott, danke ihm und du wirst inneren Frieden finden.»
«Einer Fata Morgana danken? Wofür?» fragte ich frech. «Da wird Religion wirklich Opium fürs Volk.»
In einem Kirchenblatt Religion als «Opium fürs Volk» zu bezeichnen, kam 1971 einer Gotteslästerung gleich. Aber es reizte mich, die Kirche und ihre Gläubigen in ihrer Selbstgerechtigkeit aufzustören. Ich war schon damals empfindlich für alles, was nicht in Frage gestellt werden durfte. Nichts war für mich selbstverständlich und sakrosankt. Ich wollte alles selber durchdenken und meine Gedanken äussern, ohne vorauszuberechnen, was sie möglicherweise bewirkten. Es ging mir nicht um die blosse Provokation, aber wenn ich auf Widerspruch stiess, dann gefiel mir das.
Mit meinem Leserbrief bekundete ich zum ersten mal öffentlich eine Eigenschaft, die mich mein ganzes weiteres Leben begleiten sollte. Immer wieder eckte ich an mit dem, was ich dachte und aussprach. Ich polarisierte. Auch damals, nach dem Erscheinen meiner Zuschrift im Kirchenblatt, liessen die Reaktionen nicht auf sich warten.
«Da glaubt also ein 16-jähriger Mittelschüler, dessen einzige Lebenserfahrung aus dem Besuch von Schulen besteht, dass er die Kirchenpredigten als Opium herabwürdigen und den Kirchgang als blosse Sonntagsfreude für alte Leute bezeichnen müsse. Ich gehöre zu diesen alten Leuten, aber ich wende mich ganz entschieden gegen diese geringschätzige Beurteilung unserer Gottesdienste. Ich spreche diesem Jüngling jedes Recht ab, sich derart zu äussern, und bedaure es ausserordentlich, dass ein solcher Artikel im Kirchenboten veröffentlicht wurde.» E.B.
E.B. war nicht der Einzige, der sich so äusserte. Auch andere Leserbriefschreiber fühlten sich von mir angegriffen. «Jaja, mein Junge», tadelte mich ein weiterer Kirchgänger, «erst 16 und schon so gescheite Worte. Welche Überheblichkeit!
Damals hatte die Jugend noch nicht den Bonus, den sie heute besitzt. Ein erst Sechzehnjähriger hatte noch nichts zu sagen. Dabei beliess ich es nicht bei blosser Kritik an der Kirche. Ich suchte nach eigenen Antworten.
«Was ist Religion?» fragte ich. «Sicher finde ich sie nicht in der Kirche, sondern im Leben. Die Bibel soll reine Anregung zum Denken und Handeln sein. Religion nicht als Balsam für die Seele – sondern als Lebenshilfe.»
Mit Bedauern stellte ich fest, dass die Erwachsenen sich mit meinen Gedanken schon gar nicht erst auseinandersetzten. Doch dann folgte eine weitere Zuschrift:
«Ich gehöre ebenfalls zur älteren Generation, und ich habe am Sonntag oft das Bedürfnis, in die Kirche zu gehen. Aber auch ich fühle mich nicht von allen Predigten im gleichen Mass angesprochen. Einige empfinde auch ich nur als Berieselung, zu wenig lebensnah. Es ist mir deshalb unverständlich, was der Leser E.B. gegen den aufrichtigen Brief des jungen Kantonsschülers hat. Erstens ist dieser bar jeglichen Spottes und zweitens verlangt er nicht, wir Alten sollten seine Auffassung teilen. Er vertritt lediglich seine Meinung, und dazu hat er sein volles Recht.« E. Sch.
So sehr es mich freute, einige ältere Herren in ihrer Kirchentreue betupft zu haben, so sehr ich mich in ihrer Entrüstung sonnte – so sehr brauchte ich auch den Zuspruch, das Lob. Leserbriefschreiber E.Sch. tat mir gut. Ich fühlte mich von ihm ernstgenommen, und das brauchte ich. Denn auch ich wollte geliebt werden – und als Heranwachsender war ich besonders liebesbedürftig.
Die Liebe meiner Eltern genügte mir nicht mehr. Sie durfte mir nicht mehr genügen, sonst hätte ich das Nest nicht verlassen können. Doch die Bestätigung, die ich durch meine öffentlichen Aktivitäten erhielt, konnte mir nicht ersetzen, was mir noch immer fehlte: das Glück einer ersten Liebe. Zwar erkannte ich schon – und schrieb mir die Finger darüber im Tagebuch wund –, dass öffentlicher Erfolg private Enttäuschung nicht wiedergutmachen kann.
Doch wo war es, das Mädchen meiner Träume?
___________
Alle Folgen von «Als ich mich in die Welt verliebte»