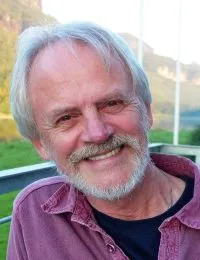Heute hatte ich mit einer Neuerscheinung des Rowohlt Verlags zu tun: «Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde – Gegen die Kriegstüchtigkeit» von Ole Nymoen. Und beinahe zwangsläufig – schlimm, dass sich auch mir bereits ein solche Frage stellt – überlegte ich: Und du? Würdest du denn kämpfen für dein Land? Und wie «aus der Pistole geschossen» kam die Antwort: nie und never. Nicht allzu sehr, aber doch überrascht fragte ich meine innere Stimme: Ja, warum denn nicht? Bist du etwa ein Defätist?
Nun gut, das Wort Defätist ist meinem Alter geschuldet. Es kann gut sein, dass die meisten Leser und Leserinnen dieses Textes nicht wissen, was damit gemeint ist bzw. war. Und das ist gar nicht gut, denn wenn man die Geschichte dieses Wortes kennt, versteht man so einiges, was an Zeitgeist momentan – von Unterschwelligkeiten begleitet – durch die öffentlichen Debatten geistert.
Die Bevölkerung auf bedingungslosen Durchhaltewillen einschwören
Das Fremdwort «Defätist» leitet sich ab vom französischen défaite = Niederlage. Im Nationalsozialismus war es zunächst «nur» ein Schimpfwort für Kriegsgegner, wurde aber bald strafrechtlich relevant. Wer sich kritisch oder mit pessimistischen Aussagen zum Krieg äusserte, konnte als Defätist verklagt werden. Defätisten wurden in der NS-Propaganda in eine Reihe mit Saboteuren, Spionen oder «Volksfeinden» gestellt. Joseph Goebbels erklärte in einer Rede 1943 nach der Niederlage von Stalingrad: «Defätisten sind gefährlicher als feindliche Soldaten. Sie müssen mit aller Härte bekämpft werden!» Dementsprechend verhängte der durch den Weisse-Rose-Prozess bekannt gewordene Nazi-Richter Roland Freisler etliche Todesurteile wegen Defätismus, damals auf Deutsch: Wehrkraftzersetzung. Zusammenfassend: Der Begriff diente dazu, jegliche Kritik am deutschen Militarismus im Keim zu ersticken und die Bevölkerung auf bedingungslosen Durchhaltewillen einzuschwören. Man kann davon ausgehen, dass sechs Jahre ununterbrochener Propaganda gegen Defätismus die Mentalität der Deutschen nachhaltig geprägt hat.
Der Begriff ist wegen seiner Nähe zur Nazi-Propaganda unbeliebt, und zugegeben, heute wird niemand mehr wegen kriegskritischer Meinungsäusserungen mit dem Tode bestraft. Mit einem Verlust des öffentlichen Ansehens muss er oder sie freilich rechnen; möglicherweise auch mit Stimmverlusten bei der nächsten Landtags- oder Bundestagswahl. Angeführt habe ich diese Zusammenhänge, um zu zeigen, welche gefährlichen Unterströmungen in der Volksseele eventuell noch herrschen und für die rechte (!) Gesinnung sorgen, u. a. eben auch für den rechten Wehrwillen, an dem mittlerweile ja sogar Frauen teilnehmen dürfen (ein in diesem Zusammenhang besonderer intellektuell-ethischer Leckerbissen: die kämpfende und folglich auch tötende Schwangere).
Wo ist mein Land?
Aber zurück zu mir. Ja, ich bekenne mich zum Defätismus und bin schon gespannt, welche kleinen Freislers bei diesem Geständnis aufheulen werden. Rosa Luxemburgs Diktum, Freiheit sei immer die Freiheit des Andersdenkenden, gilt ja schon eine Weile nicht mehr; dass die freiheitliche Gesinnung der Sozialistin im Landwehrkanal endete, nimmt einen nicht wunder und würde inzwischen auch heute nicht mehr unbedingt erstaunen. Und dass das christliche Gebot der Feindesliebe hauptsächlich dann gilt, wenn grade kein Feind öffentlich definiert wird, ist ebenfalls offenkundig.
Kämpfen für mein Land: Wieso sollte ich das tun? Das beginnt schon mit dem Wort «Land». Das war nämlich am 2. Oktober 1990 noch ein anderes als zwei Tage später. Und man braucht keinen Philosophen zu bemühen, um zu sagen, dass die BRD und das wiedervereinigte Deutschland zwei verschiedene Länder waren und sind. Solche mentalen Grenzverschiebungen kann man nahtlos zurückverfolgen: Was war mein Land vor dem 12. März 1938 und was war es nach dem sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich? Eine besonders delikate Frage: Was war mein Land zwischen dem 8. Mai 1945, dem Ende der Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs, und dem 23. Mai 1949, dem offiziellen Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland? War Deutschland in diesen vier Jahren «mein Land»? Vielleicht war dieses «Niemandsland» das beste Deutschland, das es je gab? Oder war das 1871 gegründete Deutsche Reich «mein Land» und Kaiser Wilhelm mein oberster Dienstherr? Über den Deutschen Bund oder das Heilige Römische Reich wollen wir gar nicht erst reden.
Ist mein Land «mein» Land?
Ich habe das nicht angeführt, um den Begriff «Land» – Deutschland oder welches auch immer – als Argument ad absurdum zu führen (obwohl ich das innerlich durchaus so empfinde), sondern um auf den schillernden Inhalt des Begriffes «Land» aufmerksam zu machen. Das wird nicht besser, wenn ich zum Wort «Land» allen Ernstes noch das Possessivpronomen hinzufüge: «mein Land». Ich sehe nicht, wie und wo dieses Land das meine wäre. Tatsächlich lebe ich auf einem Grundstück von ca. 500 Quadratmetern, aber nicht einmal das gehört mir, sondern ist via Erbpacht auf 99 Jahre angemietet. Also: Wem gehört die Bundesrepublik Deutschland? Der EU? Der NATO? Irgendwelchen Kapitalisten? Genaugenommen «eigentlich» niemandem, ausser sich selbst – ganz gewiss aber nicht mir.
Betrachtet man sich die Besitzverhältnisse innerhalb dieses Staatsgebildes, dann gibt uns das Managermagazin diese zehn reichsten Deutschen bekannt: Dieter Schwarz (Lidl, Kaufland, geschätztes Vermögen 43,7 Milliarden Euro), Susanne Klatten und Stefan Quandt (BMW, geschätztes Vermögen derzeit «nur» 34,4 Milliarden Euro), Familie Merck (Pharma- und Chemiekonzern, geschätztes Vermögen 33,8 Milliarden Euro), Familie Reimann (JAB Holding, geschätztes Vermögen 31,3 Milliarden Euro), Klaus-Michael Kühne (Logistik, Hotels und Lufthansa, geschätztes Vermögen 29,0 Milliarden Euro), Familien Albrecht und Heister (Aldi Süd, geschätztes Vermögen 27,0 Milliarden Euro), Familie Henkel (Konsumgüter, geschätztes Vermögen 24,6 Milliarden Euro), Familie Porsche (Automobilsektor, geschätztes Vermögen 19,3 Milliarden Euro, Familie Theo Albrecht junior und Familie Babette Albrecht (Aldi Nord, geschätztes Vermögen 18,9 Milliarden Euro), Andreas von Bechtolsheim (Netzwerktechnik, geschätztes Vermögen 17,7 Milliarden Euro).
Und Sie, können Sie wenigstens mit einer Milliarde punkten? Momentan geht man davon aus, dass fünf Prozent der Bevölkerung 50 Prozent des hiesigen Vermögens besitzen, Daumen mal Pi. Überwiegend würde ich also nicht für mein Land kämpfen, sondern dafür, dass diese fünf Prozent weiterhin 50 Prozent von Deutschland im Griff behalten dürfen. Dass ich darüber hinaus auch den Rüstungsexporteuren Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Thyssenkrupp und Hensoldt zusätzliches Geld zuscheffeln würde, könnte ich an dieser Stelle glatt vergessen. Zusammenfassend und möglichst nüchtern formuliert: Dieses Land ist eher ihr Land als mein Land. Und ich denke mal, es ist kein abwegiger Gedanke, dass die erwähnten fünf Prozent ein Grossteil ihres Vermögens ausserhalb von Deutschland ins Trockene gebracht haben, ihnen also «unser Land» ziemlich egal ist, solange die Kohle stimmt. Kleine Zusatzfrage: Wenn ich nun auswanderte, zum Beispiel nach Mexiko: Müsste ich dann dort auch für «mein Land» sterben – oder für mein Geburtsland?
Um für diesen Staat bereit zu sein zu sterben, müsste ich mich tatsächlich 1:1 mit ihm identifizieren, so dass ich seine Bedrohung auch 1:1 als die meine empfände. Aber so ist es nun mal nicht, auch wenn mir das gerade als politisch korrektes Verhalten abgefordert ist (und im gegenteiligen Fall gerne abgestraft wird). Weder habe ich mir diesen Staat als Aufenthaltsort und Gegenstand meiner Identifikation ausgesucht noch seine Lenker und Nutzniesser, die mich als nützlichen, abschlachtbereiten Idioten vor ihren Karren spannen wollen. Diese Rolle überlasse ich ihnen gerne.
Mein Land ist längst überflüssig
Zu alldem gibt es eine weitergreifende Überlegung dahingehend, dass der Nationalstaat angesichts der weltweiten, alle Menschen betreffenden Probleme wie Artensterben, Wald- und Bodenvernichtung, Trinkwasserknappheit und Erderwärmung wie ein Wurmfortsatz der Geschichte wirkt und definitiv nichts ist, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Tatsächlich steht das Anhaften an «mein Land» einer Lösung all dieser Probleme im Weg. Dennoch gibt es Autoren wie Leon Holly, der meint, im Zweifelsfall kämpfe er nicht «für», sondern «gegen». Sorry, aber das ist nun wirklich Quatsch. Ich halte dagegen: Im Zweifelsfall bedeutet mein Nichtkämpfen: da sein können für meine Kinder, meine Frau, meine Freunde, meine Enkel, meine Heimat (ein Begriff, den ich nur ungern Nationalisten überlasse). Bei einer gegenteiligen Entscheidung wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich ganz einfach nicht mehr da wäre, die Befehlsgeber aber schon – auf beiden Seiten übrigens. Ein weiteres, auf den ersten Blick plausibles Pro-Kriegs-Argument lautet: Mein Kampf wäre ein Kampf für jene, die nicht kämpfen oder fliehen können, die Alten, Schwachen, die Kinder, Ausländer ohne Pass. Auch das ist eine realitätsfreie Theorie; denn nur ohne Krieg haben diese Bevölkerungsgruppen eine gute Überlebenschance; das heisst: Sobald ich kämpfe, trage ich aktiv zu deren Vernichtung bei.
Und zum Schluss ein ganz defätistischer Gedanke: Ob ein Krieg stattfindet oder nicht, entscheidet nicht das Volk, das gestatten sich immer nur ein paar Leute. Das sind aber keine Clan-Häuptlinge, die sich in der vordersten Linie in den Kampf werfen, sondern Schreibtischtäter mit der üblen Gewohnheit, die von ihnen angezettelten Kriege zu überleben. Das ist nur das eine; das andere ist: Würde ich in den Krieg ziehen, dann zöge ich im Endeffekt diesen (oder solchen) Menschen zuliebe in den Krieg. Erst wenn mir ihre Kriegspropaganda ausreichend einleuchtet, erst wenn sie auch meine Seele erobert und meinen (Über-)Lebenswillen gelähmt haben, dann bin ich bereit, pro patria mori – fürs Vaterland zu sterben. Aber sind diese Menschen, ja ist nur ein einziger dieser Konsorten so integer, so vorbildlich, ein so menschlich grosses Vorbild, dass ich bereit wäre, für sie oder ihn zu sterben? Mir ist keine*r bekannt. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Wofür würde ich kämpfen?
Zu guter Letzt: Gibt es denn gar nichts, wofür ich kämpfen würde? Genau weiss man das natürlich erst, wenn es so weit wäre; aber ich nehme mal an, wenn es ganz konkret um das Leben meiner Familie und Freunde – vielleicht sogar meiner Nachbarn – ginge und ich sie nicht anders retten könnte, wäre ich zum Kampf bereit – wie jedes Lebewesen; nicht aber, wenn mir jemand von dieser Bedrohung nur erzählt. An Märchen glaube ich schon länger nicht mehr. Kämpfen würde ich – vielleicht oder wahrscheinlich – gegen einen physisch wahrnehmbaren Angreifer, der mir offenkundig lebensgefährlich Böses will. Die Soldaten des Feindes sind aber solche Angreifer grundsätzlich erst einmal nicht. Bob Dylan hat das so formuliert:
Like a dog on a chain | He ain't got no name | But it ain't him to blame | He's only a pawn in their game.
Und genau das will ich nicht sein: a pawn in the game – ein Bauer im Schachspiel der Grossen. Die wollen nichts weiter als ihre Interessen durchsetzen, strategische Positionen erringen, ihre Territorien erweitern, an Rohstoffe herankommen etc.; dafür wird auch gerne und im grossen Stil gelogen, um den Kampfeswillen der Bevölkerung effektvoll anzuheizen. Mein Befinden, meine Person, mein Lebenswille, mein Freundeskreis und meine Kinder sind ihnen schnurzegal. Mich für dieses Egalsein, für meine Schachfigurenrolle abschlachten zu lassen, finde ich nicht nur inakzeptabel, sondern auf menschlicher Ebene geradezu erniedrigend, und zwar für jede*n von uns. Wer das mag, der soll es tun, und die Eltern, die bereit sind, ihre Kinder verheizen zu lassen, sollen sie an die Schlachtbank führen, ich jedenfalls werde nicht kämpfen für mein Mutterland. Und meine Kinder und Enkel hoffentlich auch nicht.