Die repräsentative Demokratie ist in die Jahre gekommen. In vielen existentiellen Fragen ist das «Volk» von echter Entscheidungsmöglichkeit und politischer Gestaltungsmacht heute genauso meilenweit entfernt wie zur Zeit der Könige und Kaiser. Wenn wir bei der Entwicklung des Automobils genauso zaghaft und selbstzufrieden gewesen wären wie bei der Entwicklung unserer Demokratie, würden wir heute noch mit Gefährten herumfahren, die Räder mit Vollgummireifen besässen und vor dem Start mit einer Handkurbel angeworfen werden müssten.
Moderne Basisdemokratie ist die Übersetzung eines uralten Menschheitstraumes in die politische Begrifflichkeit der Gegenwart. Direkte Demokratie und Räte, beides Elemente der Basisdemokratie, wurden Anfang des20. Jhd. in Deutschland, der Sowjetunion und Spanien pobiert – mit schlechten und guten Erfahrungen, aus denen wir lernen können. Heute bilden die Kurdinnen und Kurden der Region Rojava in Nordsyrien das aktuellste Beispiel gelebter Basisdemokratie. Doch gehören noch mehr Komponenten dazu, von denen einige kaum im Bewusstsein sind.
- Basisgemeinschaften sind menschliche Gliederungen, gross genug, um eine gewisse Vielfalt - und klein genug, um Überschaubarkeit zu gewährleisten (ca. 300 Menschen). Es braucht Gemeinschaften als Schutzmembran zwischen dem Individuum und der anonymen Masse. Basisgemeinschaften sind idealerweise gleichzeitig Entstehungsort politischer Willensbildung und gemeinsame Lebensfürsorge. Wichtig ist Vielfalt: Vielfalt an Können, Wissen und Fähigkeiten, Geschlechter, Generationen.
- Echte Subsidiarität: Was die kleinste Einheit an der Basis selbst regeln kann, darf sie auch. Nur was sie freiwillig an grössere Verbände delegiert, wir von dort geregelt. Alle Aufgaben, die delegiert hat, kann sie sich auch wieder zurückholen. (Z.B. Schule)
- Der gegliederte Konsens (z.B. in Frauen- und Männerkreisen) gewährleistet, dass die Kreativität, Kompetenz und soziale Intelligenz von Frauen und Männern gleichermassen zur Entfaltung kommt. Es gibt bei der Willensbildung auch Traditionen und Verfahren, wie Jugendliche, Kinder und sogar nichtmenschliche Wesen einer Gemeinschaft darin eingebunden werden können. (z.B. Konferenz des Lebens nach Joana Macy.)
- Direkte Demokratie: Direktdemokratische Entscheidungen prägen vor allem das Innere der Basisgemeinschaften. Wenn die Verbände zweiter Ordnung (Gemeinden) klein genug sind, um noch eine gewisse Überschaubarkeit zu gewährleisten, findet sie auch da noch Anwendung.
- Rätesystem: Beim Transport basisdemokratischer Entscheidungen in die grösseren Verbände kommt dann das Rätesystem zu Zuge. Das basiert auf der permanenten Rückkopplung mit den Basisgemeinschaften. D.h.: Ein Rat, der aus je zwei Frauen und zwei Männern pro Basisgemeinschaft beschickt wird, entscheidet nicht für oder anstelle seiner Basiseinheiten, sondern moderiert deren Interessen zu einer gemeinsamen Willensbildung. Das kann bedeuten, dass die Räte öfters hin und her gehen müssen.
- Das gebundene Mandat: Frauen und Männer, die von einer Gemeinschaft als Delegierte in einen Rat gesandt werden, bleiben an den Willen ihrer Basis gebunden. Wenn sie das nicht tun, können sie jederzeit von ihrem Mandat entbunden und durch andere Delegierte ersetzt werden.
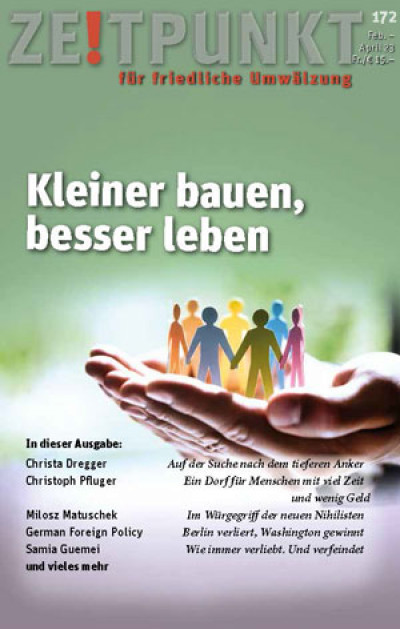 Der Beitrag erschien im Zeitpunkt Nr. 172:
Der Beitrag erschien im Zeitpunkt Nr. 172:





