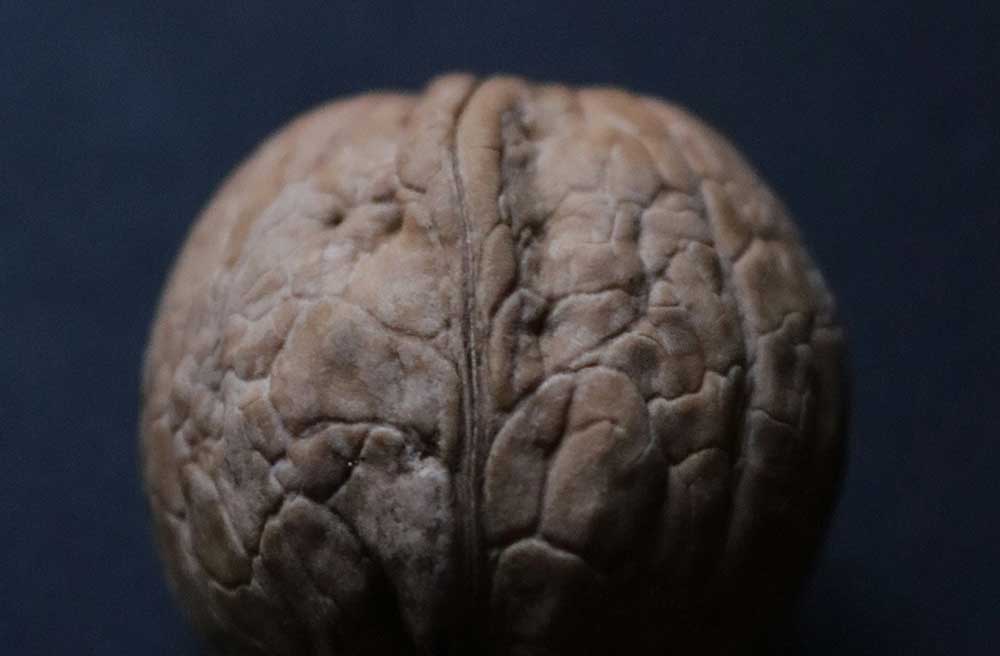Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn im Essay ging es um «Othering» [Andersmachung]. Die Verwendung von Ausdrücken wie links und rechts schafft einen Begriffsrahmen, der die Wir-gegen-Die-Politik unausweichlich macht. Insofern enthielt mein Essay einen Widerspruch in sich.
Obendrein säen diese Begriffe Verwirrung und Missverständnis, weil sie für unterschiedliche Menschen Unterschiedliches bedeuten. Leute auf der «rechten» Seite nennen zum Beispiel Hillary Clinton eine Linke, aber wenige, die sich selbst als links definieren, würden dem zustimmen. Dagegen bezeichnen die Medien jemanden wie Glenn Greenwald [US-amerikanischer Journalist, der die von Edward Snowden übermittelten Dokumente veröffentlichte] als «rechts», obwohl er Positionen vertritt, die noch vor fünfzehn Jahren als links gegolten hätten.
Rechts und links sind willkürliche Bezeichnungen. Sie stellen keine objektive Realität dar – so wie etwa die zwei Seiten desselben Gehirns. Wenn ich die politische Lage in diesen Begriffen darstelle, verstärke ich also eine unnötige, künstliche Spaltung.
Warum sollten wir überhaupt davon ausgehen, dass das Gemeinwesen von Natur aus in zwei Hälften geteilt ist? Denn das suggerieren diese Bezeichnungen. Man könnte genauso gut andere Einteilungen verwenden: Quadranten anstatt Linien, vielleicht Spiralen oder Fraktale, um die politische Ordnung zu beschreiben.
Naja, vielleicht nicht «genauso gut». Der Reiz des Links-Rechts-Schemas liegt zum Teil in seiner Einfachheit. Psychologisch gesehen ist das einfachste (und kindlichste) Drama eines mit zwei Seiten: einer richtigen und einer falschen. Kinder inszenieren das die ganze Zeit, und wenn sie die passenden Modelle und sozialen Bedingungen bekommen, lernen sie dessen Grenzen kennen und können darüber hinaus wachsen.
Unsere Gesellschaft steckt dagegen anscheinend in binären Kategorien, die nicht sehr sinnvoll sind. Bedeutet «links»: «Wer sich als links identifiziert»? Oder bedeutet es: «Wer von anderen als links identifiziert wird»? Genauso für rechts.
Die Bezeichnungen sind unscharf. Hinzu kommt, dass die Ideen, unter denen diese Gruppen zusammenfinden, nicht statisch sind. Sicher, sie stammen jeweils aus einem langen geschichtlichen Diskurs. Aber in letzter Zeit haben sich die Positionen, die «rechts» oder «links» genannt werden, so dramatisch verändert, dass sie manchmal sogar die Seiten gewechselt haben.
Zum Beispiel kam während der letzten Dekade der meiste (obwohl nicht jeglicher) Widerstand gegen Krieg von der libertären Rechten. Während Corona liessen die meisten der so genannten Linken von ihrer traditionellen Verteidigung der Bürgerrechte – Ablehnung von Zensur, Feindschaft zu Grosskonzernen (z. B. Big Pharma) und Skeptizismus gegenüber den Geheimdiensten – ab, indem sie mit der Corona-Orthodoxie in Gleichschritt fielen.
«Wer ist jetzt links und wer ist rechts?», fragte ich mich oft. Die Begriffe haben ihre Brauchbarkeit verloren, ausser als Gruppenbezeichnungen. Sie beziehen sich nicht mehr auf ein durchgängiges Wertesystem.
In einer mutigen Artikelreihe «Wieso die Linke im Arsch ist» beschreibt Rhyd Wildermuth, wie die CIA nach dem zweiten Weltkrieg eine «antikommunistische Linke» finanziell und medial unterstützte. «Die Antikommunistische Linke,» sagt er, «die wir vermutlich am besten als die einzige Linke bezeichnen, die eine Existenzerlaubnis hat, stellt keine Bedrohung und noch nicht einmal ein Hindernis für den Fortbestand des Kapitalismus dar.» Hauptsächlich dank des CIA-Einflusses hat die Linke den Klassenkampf weitgehend durch intersektionale Identitätskämpfe ersetzt.
Wildermuth führt aus:
Diese «Neue Linke» hat frühere und rivalisierende Linksorientierungen abgewürgt, indem sie ihnen Beachtung und Publicity abjagte. Sie wurde zu der Linken, die an Universitäten gelehrt wurde, und schuf eine neue Generation Radikaler, die sich eher an den Feinheiten von Gender-, Rassen- und kolonialer Unterdrückung abarbeitet als daran, wie die Reichen zu bekämpfen wären.
Obwohl es «kultureller Marxismus» genannt wird, hat das heutige Links wenig mit Marx zu tun. Denn der Kapitalismus funktioniert ganz prima, egal welcher Rasse, Geschlechtszugehörigkeit oder sexueller Präferenz seine Funktionäre zuzurechnen sind.
Randbemerkung: Kapitalistisch/antikapitalistisch schafft schon wieder eine künstliche Trennung. Die Natur des Kapitalismus hängt ab von der Natur des Kapitals, aber Kapital – Geld und Besitz – ist eigentlich nur ein System gesellschaftlicher Übereinkünfte. Die marxistische Definition des Kapitalismus ist das private Eigentum an den Produktionsmitteln. «Eigentum» ist jedoch keine Alles-oder-nichts-Angelegenheit. Eigentum gehört nicht zu deinem Körper; es gehört dir nicht wie ein Arm oder ein Bein; es gehört dir nur, weil Menschen darin übereingekommen sind, dass du besondere Rechte daran hast. Diese Rechte sind nicht absolut.
Ich bin vielleicht der «Eigentümer» eines Grundstücks, auf dem mein Haus steht, aber ich kann darauf keine Tierkörperbeseitigungsanlage oder Giftmülldeponie bauen. Sobald das Wesen der Übereinkünfte namens Geld und Besitz sich verändert, verändert sich auch das Wesen des Kapitals und damit das Wesen des Kapitalismus.
Mein Buch «Ökonomie der Verbundenheit» zeigt auf, wie die Internalisierung negativer externer Wirkungen und die Abschaffung von «ökonomischen Renditen» Geld und Besitz auf eine Post-Mangel-Welt und auf die Prinzipien des Schenkens ausrichten.
Eine befreundete bekennende Linke nannte mir eine hilfreiche Abgrenzung. Sie sagte, dass es innerhalb der Linken eine zunehmende Polarisierung gebe zwischen der, wie sie sie nannte «andersmachenden Linken» und der «Versöhnungslinken». Erstere legt Wert auf Bestrafung, Wir-gegen-Die und «Schlag drauf»-Politik. Letztere stimmt voll mit den Ideen in meinem Einwanderungs-Artikel überein. (In der Tat verdanke ich die meisten dieser Ideen jahrzehntlangem Lesen in der linken Tradition.) Sie nennt sie auch die «zuhörende Linke».
Eine ähnliche Abgrenzung könnte man auch innerhalb der Rechten vornehmen. Tatsächlich beleidigt es die Vernunft, wenn man unverbesserliche Kriegstreiber wie Lindsey Graham und John Bolton in dieselbe politische Kategorie eingruppiert wie Kriegsgegner wie Rand Paul und Tulsi Gabbard, oder hasserfüllte Ideologen wie Glenn Beck mit nachdenklichen, sich weiterentwickelnden und als rechts identifizierten Journalisten wie Tucker Carlson. Carlson, der sich immer noch als konservativ bezeichnet, wäre ein sehr gutes Beispiel für die «zuhörende Rechte».
Wenn wir die Links-Rechts-Begrifflichkeit und das bipolare Wir-gegen-Die-Denken, das damit einhergeht, weglassen, tauchen andere Fragen auf, mit deren Hilfe wir unsere politischen Akteureverstehen können. Hören sie zu? Verändern sie sich? Behandeln sie diejenigen, die eine andere Meinung haben, fair und grossherzig? Suchen sie Wahrheiten, die ausserhalb ihrer eigenen Perspektiven sichtbar werden?
In dem Masse, wie unsere Führungspersönlichkeiten und wir selbst diese Tugenden verinnerlichen, wird die Gesellschaft in der Lage sein, ihre fortwährenden Konflikte zu lösen. Dialog wird möglich. Wir können unsere Unterschiede überbrücken. Krieg, Genozid, Ökozid, Ausbeutung und Unterdrückung verschwinden im Licht des Mitgefühls. Mitgefühl ist das Herz des Zuhörens. Wahrhaftig zuzuhören bedeutet, in den Mokassins eines anderen zu gehen. Wie sieht dann die Welt für dich aus, und wie fühlt sie sich an?
Wer zuhört, wird gewahr, wie vielschichtig die Anlässe sind, die Konflikte schaffen. Wir-Die- sowie Rechts-Links-Denken legt eine einfache Lösung für alle Probleme nahe: nämlich die andere Seite zu besiegen im politischen – oder militärischen – Kampf. Daher das schreckliche Drama, das sich im Nahen Osten abspielt. Wenn wir wirklich vom Anderen getrennt wären, dann könnte diese Lösung oft funktionieren. Aber wenn Selbst und Anderes einander spiegeln, einander enthalten und einander stützen, dann wird jegliches Problem, das durch den Sieg über das Andere gelöst wurde, in irgendeiner neuen Form wiederkehren.
Eine weitere Folge des politischen Zuhörens ist der Zusammenbruch der Narrative, die jede Seite in ihrem Richtigsein gefangen hält. Um Wir zu bleiben, muss jede Seite alle Informationen ausklammern, die die andere vermenschlichen oder wertschätzen oder den Auseinandersetzungen Vielschichtigkeit und Zwischentöne hinzufügen. Tückischerweise müssen beide Seiten auch noch zusammenarbeiten, um ihren Kriegsschauplatz aufrecht zu erhalten und jede darüber hinaus gehende Erklärung abzulehnen, die ihn unwichtig machen würde.
Wenn die Informationen, die sie übereinstimmend aussen vor lassen, in den Blick der Öffentlichkeit gelangten, würden sie Gesellschaft und Politik grundlegend verändern. Ich rede hier von Dingen wie J. F. Kennedys Ermordung, die UFO-Enthüllungen, Freie Energie, MK-Ultra und alle Arten von Inhalten, die Paradigmen zerstören – manche ziemlich finster und andere wundervoll. Sie müssen aus der offiziellen Wirklichkeit verbannt werden, damit unsere Abgrenzungen weiterhin funktionieren.
Da die Begriffe links und rechts die Denkweise von uns und den anderen nähren, werde ich sie nicht mehr gedankenlos verwenden. Ich würde auch gern einen neuen Begriff in unser politisches Wörterbuch einfügen, als Erwiderung auf den Vorwurf des «Beide-Seiten-Denkens». Was wir unbedingt aufgeben sollten, ist das «Zwei-Seiten-Denken». Wir müssen uns von der mentalen Schablone lösen, die jedes Drama auf Bipolarität reduziert. Ich werde vorsichtiger sein, um durch meine Wortwahl das Zwei-Seiten-Denken nicht mehr zu nähren, und ich hoffe, dass andere mitmachen.
Mit dieser Gewohnheit zu brechen, dürfte allerdings nicht einfach sein. Es ist so verlockend, das Furchtbare in den anderen Leuten heraufzubeschwören, um in uns, den guten Leuten, die Leidenschaft zu erwecken, mit der wir uns ihnen entgegenstellen. Diese Empörung kann man in Likes, Follower, Abonnenten, Voten, Geld, Macht kanalisieren.
Das ist das Altbekannte, Bewährte. Aber mit jedem Mal, dass wir so handeln, fachen wir das Feuer, das unsere Welt vernichtet, etwas mehr an.
Übersetzt und korrekturgelesen von Ingrid Suprayan und Christa Dregger. Die englische Originalfassung dieses Essays vom 16. Juni 2025 – «Moving Beyond Two Sides-ism» – findest du hier.