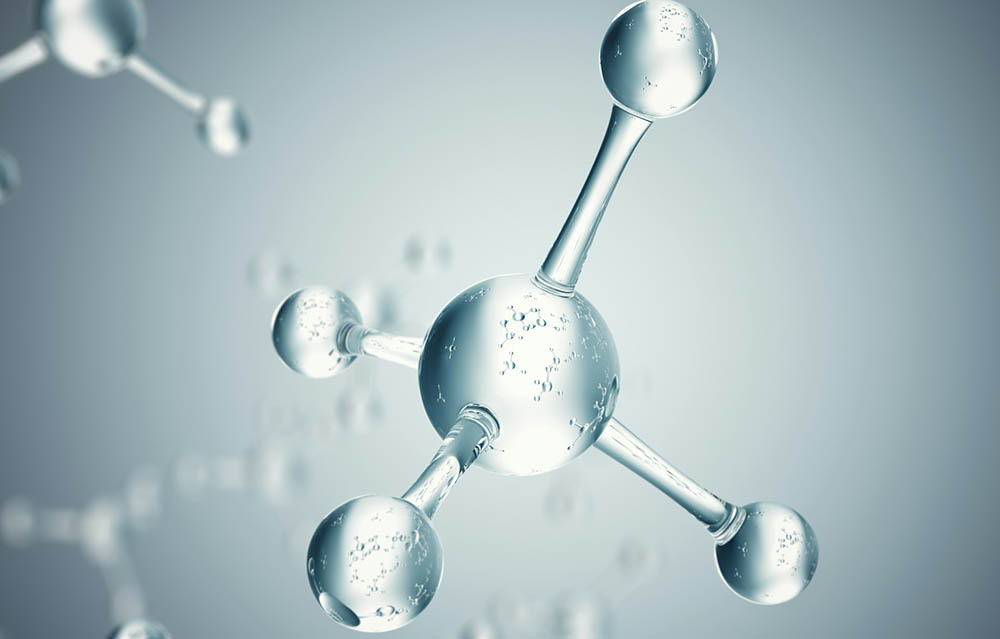Science und Nature heissen die beiden renommiertesten wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Mit ihren Peer-Reviews und hohen Standards an Faktentreue und Wahrhaftigkeit haben sie sich diesen Ruf erworben. Einfach irgendwas behaupten, das geht für sie nicht. Wissenschaft muss intersubjektiv überprüfbar sein. Ein Experiment muss von anderen Forschern wiederholt werden können und dann zum gleichen Ergebnis kommen, sonst gilt es nicht als valide.
Hätten politische Aussagen ebenso strenge Mechanismen der Selbstkorrektur, die Welt sähe anders aus. Deshalb wünschen sich viele von uns mehr Wissenschaft und mehr Einfluss der Wissenschaften auf die Politik. Doch hat auch die Wissenschaft, betrachtet man sie ausserhalb ihres gesellschaftlichen Kontextes, ihre Schattenseiten. Die liegen nicht in ihrer Methode, sondern im gesellschaftlichen, individuellen und institutionellen Umgang mit ihr.
Seit Trumps erster Amtszeit und der Aussage seiner damaligen Pressesprecherin, dass eine Lüge von ihm doch auch als «alternative Wirklichkeit» aufgefasst werden könne, setzen die Medien mehr denn je ihre Hoffnung auf Faktenchecks. «Fake-News» sind die Feinde dieser Faktenprüfer, umso mehr, da diese inzwischen durch KI noch viel täuschender auftreten.
Ist diese Hoffnung gerechtfertigt?
Nachdem ich in den 70er Jahren in München acht Semester lang im Fach «Wissenschaftstheorie und Logik« die Methodik von Science – auf deutsch: Naturwissenschaft – hingebungsvoll studiert habe, hege ich diese Hoffnung auch heute noch. «Eigentlich» müsste die Wissenschaft das doch können. Warum kann sie es offenbar dennoch nicht?
Für die Fans der exakten Wissenschaften, zu denen ich auch mich zähle, möchte ich zunächst zur Ernüchterung ein paar der Rätsel aufzählen, welche die Science bisher nicht hat lösen können. Das grösste dieser Rätsel zuerst: Wie kommt Bewusstsein in die Materie? Dafür gibt es unter Wissenschaftlern keine schlüssige Antwort. Ein paar weitere der Rätsel sind die folgenden: Warum fasziniert uns Musik? Warum müssen wir schlafen? Warum träumen wir? Was ist Liebe, und warum ist sie für uns Menschen so wichtig?
Den folgenden Einwand gegen die schöne Idee einer nur der Wahrheit verpflichteten Wissenschaft halte ich in den heute wieder so kriegslüsternen Zeiten für besonders triftig: Die Wissenschaft untersucht das, wofür ihre Auftraggeber sie bezahlen. Deshalb gibt es mehr als hundert Mal so viel Forschung über Militär, Waffen, Kriegsgerät und kriegerische Strategien als Friedensforschung. Wer bezahlt schon Friedensforschung? Für Waffen und die diesbezügliche Forschung aber findet sich immer genug Geld. Drohnen, Cyber War, KI in der Kriegsführung, ABC-Waffen, psychologische Kriegsführung und die professionelle Medienmanipulation der eigenen und der gegnerischen Bevölkerung gehören mit dazu.
Mein Vater war sein Leben lang Naturwissenschaftler, spezialisiert auf die Physiologie des Riechens. Als in Zeiten des Vietnamkriegs das Pentagon bei ihm anfragte, ob er daran interessiert sei, die Möglichkeit des Riechens von Vietkong-Kämpfern in den Dschungeln von Indochina zu erforschen, erschrak er. Für ihn war es, als hätte der Teufel ihm einen lukrativen Auftrag vor die Nase gehalten – unter Forschern ist ja bekannt, dass das Pentagon gut zahlt. Er lehnte ab. Dafür ehre ich ihn heute noch.
Es gibt jedoch in allen Gesellschaften genug Wissenschaftler, die aus finanziellen oder Karrieregründen solche Aufträge annehmen. Manchen, wie dem Atomphysiker Robert Oppenheimer, dem «Vater der Atombombe», kommen später Gewissensbisse. Aus einer jüdischen Familie stammend, hatte Oppenheimer sicherlich auch ideelle Gründe, sein Wissen dafür einzusetzen, dass den Nazis die Kernspaltung nicht zuerst gelingt. Die Vorstellung, dass das Hitler-Regime mit Atomsprengköpfen auf der V2 dem Zweiten Weltkrieg in letzter Minute doch noch eine entscheidende Wendung gegeben hätte, finde ich auch heute noch gruselig.
Die empirischen Wissenschaftler sind sicherlich Anwender der besten Fehlerkorrekturmethode, um Faktisches von Fakes zu unterscheiden. Doch sind auch sie Menschen, gesteuert von menschlichen Motiven. Dazu gehören Ideologie, Religion, Ehrgeiz, Geldgier und mehr. Da unsere kapitalistischen und angstgetriebenen Gesellschaften das Geld so viel mehr in die Rüstungsforschung als in die Friedensforschung stecken, geht der Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit auch so viel mehr dahin, welche Waffen wie gut darin sind, einem Feind beim Angriff zuvorzukommen – als in die Forschung, wie persönliche, nationale und kulturelle Konflikte vermieden und gelöst werden können. Zudem behaupten Aggressoren immer, sie würden sich nur verteidigen. Das gibt den Forschern an den Waffen das Gefühl, sich für etwas Gutes einzusetzen: Wir helfen unserem Land ja nur, sich zu verteidigen.
Aktuelle Dystopien vom Weltuntergang gibt es genug. Dazu auch die Gründe von «Realisten», warum dieser fast unvermeidlich ist und «wir aufrüsten müssen, es geht ja nicht anders. Wir haben leider einfach keine andere Wahl», so heisst es auch heute wieder.
Wie schon der visionslosen Angela Merkel einst spöttisch das politische Konzept TINA nachgesagt wurde, die Abkürzung für: There Is No Alternative. Ich setze solchen Dystopien der Kreativitätsverweigerer unverdrossen meine Utopien entgegen – Yes, I have a dream! Und ich habe nicht nur einen, sondern:
1. Die Utopie einer weltweiten Abrüstung, die Schritt für Schritt den aktuellen Aufrüstungswahnsinn deeskaliert. Den Vorwurf, damit als langer Arm des Feindes zu gelten, müssen die Vertreter dieser Utopie aushalten können. Sie sollte mit einer Absichtserklärung eingeleitet werden: Wir wollen abrüsten! Schon das wird, wenn es ehrlich gemeint ist, deeskalierend wirken.
2. Die Utopie eines UNO-Beschlusses, dass kein Land mehr Geld in militärische Forschung als in Friedensforschung investieren darf. Unterstützt von der Forderung, dass alle militärische Forschung sofort publiziert werden muss, ohne Geheimhaltung. Dann kann keine Gesellschaft mehr Vorteile aus der Kenntnis einer noch «fortschrittlicheren, innovativeren» tödlichen Waffe ziehen.
3. Subjektiv wissen wir, dass Liebe die alles überragende Frieden stiftende und Glück bringende Kraft ist. Deshalb propagiere ich die Utopie einer wissenschaftlichen Erforschung der Liebe. Welche Art Erziehung und gesellschaftliche Beeinflussung fördert die Liebesfähigkeit? Welche Kultur kann das am besten? Hierzu Lehrstühle, Akademien, Forschungsinstitute und experimentelle Gemeinschaften.
Abschliessend noch ein paar Worte zu der Behauptung, die Untersuchung des Faktischen – was Fakt ist und was Fake – würde genügen, um «die Welt zu retten» vor Irrtümern, Despoten, Desinformation oder was auch immer man gerade nicht mag. In seinem neuesten Werk »Nexus« untersucht Yuval Harari diese These ausführlich und wirft sie dann rundum überzeugend auf den Müllhaufen der Geschichte.
Mehr Information führt nicht zu mehr Wahrheit oder gar mehr Weisheit. Infoflutung bewirkt meist sogar das Gegenteil. Gutenbergs Druckerpresse hat nicht etwa die revolutionären und wissenschaftlich gut bestätigten Thesen des Kopernikus allgemein bekannt gemacht; die nahm damals kaum jemand zur Kenntnis. Der Bestseller des Jahrhunderts nach Gutenberg war gleich nach der Bibel der Hexenhammer des Inquisitors Heinrich Kramer. Die erfundenen und unbelegbaren Behauptungen dieses Buchs führten zur Ermordung von Zigtausend Unschuldiger, vor allem Frauen. Meist nachdem vorher durch Folter ein Geständnis erpresst wurde.
Auch in unserer Zeit gibt es Informationsschwemmen, die grosses Unheil anrichten. So hat etwa die Bevorzugung von «user engagement» (Nutzerbindung) durch die Algorithmen von Facebook zu unheilvollen Empörungsspiralen geführt. Der vielleicht krasseste Fall einer solchen Infodemie waren die 10er Jahre in Myanmar. Damals war Facebook das führende Nachrichtenmedium dieses Landes. Die von den Facebook-Algorithmen geförderten haltlosen Behauptungen angeblicher Gräueltaten der islamischen Minderheit der Rohingya führten zum gut belegten Genozid an ihnen (Quellen: Amnesty International; Hararis: Nexus).
Eine allein auf die Wahrheit von Fakten ausgerichtete Wissenschaft reicht nicht aus, um Unheil zu verhindern. Es braucht dazu eine Ethik. Auch wenn die Wissenschaft selbst in ihrer korrekten Anwendung keine ethischen Urteile abgibt – sie erforscht, was tatsächlich der Fall ist und nicht, was gut und was schlecht ist. Sie sollte jedoch von Ethik gesteuert sein. Wissenschaftler sollten auch ihr Gewissen einsetzen bei der Beurteilung, ob sie bereit sind, etwas zu erforschen.
Wissenschaftler sollten ihr Gewissen befragen, ob sie etwa bereit sind, so lange Studien an Rauchern zu machen, bis schliesslich eine davon ergibt, dass Rauchen nicht schadet; um dann, ganz im Sinne ihrer Auftraggeber, nur diese eine Studie zu publizieren. Noch wichtiger ist, dass die Auftraggeber von wissenschaftlicher Forschung Gutes beabsichtigen und nicht etwa die Züchtung eines tödlichen Virus oder die Performance einer vom feindlichen Radar nicht erkennbaren Drohne. Andernfalls richtet auch die peer-reviewte Wissenschaft bei aller Faktentreue grossen Schaden an.