Ziel dieses Kapitels ist es, die Dimensionen der Futtermittelimporte aufzuzeigen, ihre Bedeutung für die Schweizer Landwirtschaft und Tierproduktion zu klären und die negativen Umweltfolgen in der Schweiz und in den Herkunftsländern abzuschätzen.
Zusammenfassung
Ausgangspunkt der Analyse ist die irreführende Aussage, 84% der Futtermittel in der Schweiz würden von «einheimischen Wiesen und Feldern» stammen. Dieser Prozentwert basiert auf der Addition von Rau- und Kraftfutter, zwei Kategorien von Futtermitteln, die nicht addiert werden dürfen, da sie nur begrenzt substituierbar und damit nicht direkt vergleichbar sind.
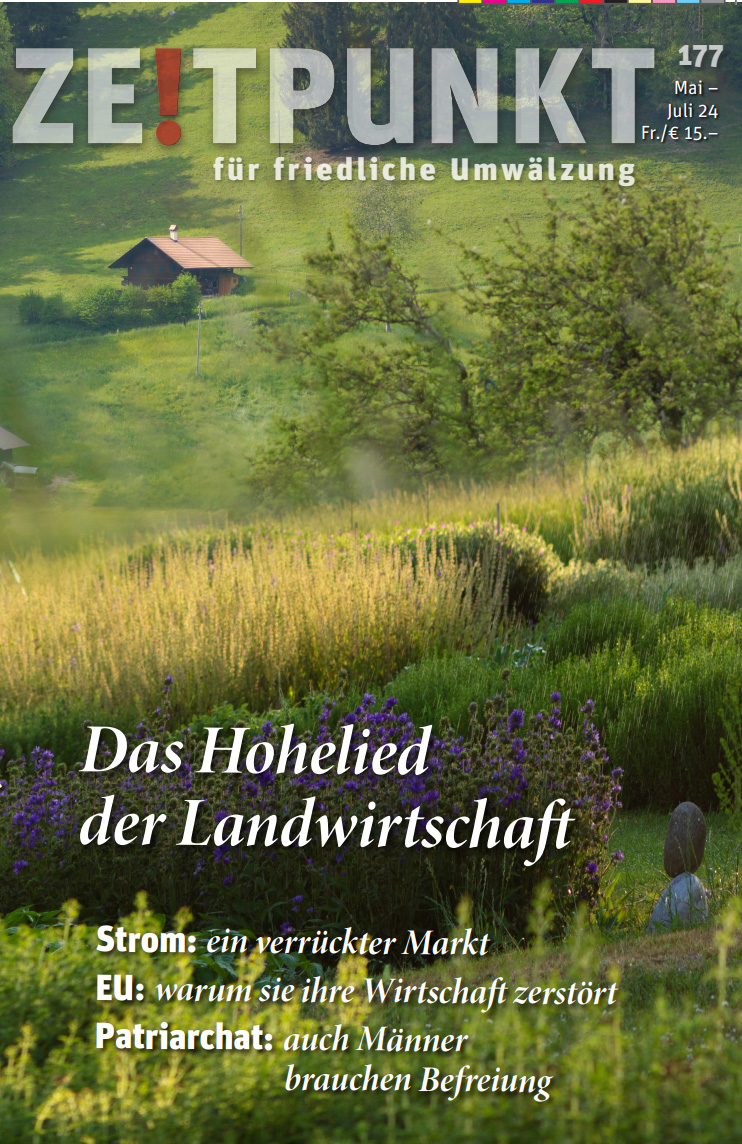
Dieser Beitrag stammt aus dem neuen Zeitpunkt-Magazins zum Thema: Das Hohelied der Landwirtschaft - hier können Sie es bestellen.
Den komplette Text von Andreas Beers veröffentlichen wir sukzessive.
Raufutter wird hauptsächlich von Wiederkäuern gefressen. Fleisch stammt jedoch hauptsächlich von Schweinen und Geflügel, die auf Kraftfutter angewiesen sind. Raufutter kommt zu gegen 100% aus dem Inland, Kraftfutter dagegen zu über 50% aus dem Ausland. Besonders knapp ist Protein: Rund 70% des Proteins im Kraftfutter stammen aus Importen (v.a. Soja).
Ohne die heutigen Futtermittelimporte würden deshalb vor allem die Tierbestände, die auf Kraftfutter angewiesen sind, deutlich zurückgehen. Gemäss Modellrechnungen könnten auf Basis von Inlandfutter 94% der Schafe und Ziegen, 85% des Rindviehs, 39% der Schweine und 17% des Geflügels gehalten werden. Die Fleischproduktion wäre mit 21 kg pro Kopf und Jahr halb so gross wie heute. Schweinefleisch bliebe die wichtigste Fleischsorte, obwohl sie im Vergleich zu heute mehr als halbiert würde. Geflügelfleisch würde praktisch verschwinden. Jedoch könnten immer noch rund 350 kg Milch pro Kopf und Jahr produziert werden.
Die Schweizer Landwirtschaft ist auf die Tierproduktion spezialisiert. Auf rund 90% der Landwirtschaftsflächen wächst Futter für Tiere. Als Folge der Futtermittelimporte kommen mindestens 200 000 Hektaren Ackerfutterflächen im Ausland hinzu. Auf diesen wachsen Sojabohnen, Weizen, Mais etc.
Seit Mitte 1990er Jahre haben die Futtermittelimporte stark zugenommen. Die meisten Futtermittel werden aus Europa importiert. Das wichtigste importierte Eiweissfutter ist Soja, aufgrund der öffentlichen Kritik stammt auch Soja vermehrt aus Europa. Die meisten importierten Futtermittel konkurrieren unmittelbar die menschliche Ernährung. Sie stammen von Kulturen, die wir Menschen direkt essen können. Dazu zählen nicht nur alle Getreidearten wie Weizen, Mais, Reis, Hafer und Gerste, sondern auch Sojabohnen.
In der intensiven Tierproduktion werden die vielen Kalorien in pflanzlichen Nahrungsmitteln, die wir Menschen direkt essen könnten, in wenige tierische Nahrungsmittel-Kalorien umgewandelt. Die Produktion von Fleisch «vernichtet» dabei deutlich mehr pflanzliche Nahrungsmittel-Kalorien als diejenige von Milch. Denn in der Milch steckt immer noch viel Gras, das nur Kühe und andere Wiederkäuer verdauen können.
Soja ist das global wichtigste Eiweissfuttermittel. Ursprünglich wurden Sojabohnen in Asien für die menschliche Ernährung kultiviert. Heute gehen rund 75% der globalen Produktionsmenge in die Tierfütterung, davon mehr als die Hälfte in die Poulet-Mast. Während global Geflügel anteilsmässig am meisten Sojaeiweissfutter frisst, steht in der Schweiz das Rindvieh an erster Stelle. Dies ist die Folge des zentralen Stellenwerts der Milchproduktion und der Zucht von Leistungsrassen, die auf proteinreiches Kraftfutter angewiesen sind.
Die globale Sojaproduktion ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, in Brasilien exponentiell. Soja wird etwa zur Hälfte in den Anbauländern verfüttert bzw. konsumiert, während die andere Hälfte international gehandelt wird. Die Hauptproduktions- und Exportländer sind die USA und Brasilien. Die Hauptimportländer sind China und die EU.
Brasilien ist immer noch die wichtigste Herkunftsregion von Schweizer Sojaimporten. Das Land baut Sojabohnen für den Weltmarkt an: rund 90% der Produktion werden exportiert. Nur 5% der Landwirtschaftsbetriebe Brasiliens kultivieren Soja, und nur 16% der Sojaanbaubetriebe sind Familienbetriebe. In den vergangenen 20 Jahren wurde die Produktion vor allem in den ökologisch wertvollen Biomen Cerrado und Amazonas ausgedehnt. Dort betragen die durchschnittlichen Sojaanbauflächen 930 ha (Amazonas) bzw. 550 ha (Cerrado).
Schweizer Futtermittelimporte – Entwicklung, Hintergründe, Folgen:
Die Lieferketten für in die Schweiz importierte Soja sind intransparent. Die Bezeichnung «verantwortungsbewusst produziert» beschönigt die Sojaproduktion in Brasilien und den Sojahandel. Gemäss Recherchen stammen die Schweizer Soja-Importe aus Brasilien von spezialisierten Grossbetrieben mit intensivem Sojaanbau, monotonen Fruchtfolgen und hohem Pestizideinsatz. Sie befinden sich mehrheitlich im Bundesstaat Mato Grosso, d.h. im Cerrado- oder Amazonas-Biom, wo in den vergangenen Jahrzehnten am meisten Flächen gerodet wurden. Auch ProTerra-zertifizierte Soja stammt von ursprünglichen Regenwald- (Amazonas) oder Savannenflächen (Cerrado). «Zero deforestation» bezieht sich nur auf das letzte Jahrzehnt.
Tierische Nahrungsmittel sind auch in der Schweiz ein Milliardengeschäft. Die Lieferketten weisen bei den Vorleistungen (Futtermittel), bei der Verarbeitung (Fleisch, Molkereimilch) sowie beim Gross- und Detailhandel eine hohe Marktkonzentration auf. Wenige Unternehmen, besonders die Mischkonzerne Coop, Migros und fenaco, dominieren die Märkte. Die Industrialisierung der Produktion in effizienten internationalen Lieferketten ist am stärksten fortgeschritten bei der Eier- und Poulet-Produktion. Die Lieferketten sind auch hier wenig transparent.
Gemäss Modellrechnungen sind von den gesamten Treibhausgas-Emissionen der Schweizer Landwirtschaft mehr als 50% direkt der Tierproduktion zuzurechnen, 20% der übrigen Landwirtschaft und rund 30% fallen in den Anbauländern der Futtermittel an. Ohne Futtermittelimporte wären die Treib- hausgas-Emissionen 40% geringer. Auch die Stickstoff-Überschüsse der Schweizer Landwirtschaft sind grösstenteils eine Folge der Tierproduktion. Mehr als 90% der Überschüsse fallen in der Schweiz an. Ohne Futtermittelimporte wären die Stickstoff-Überschüsse in der Schweiz um 26% kleiner.
Die Ergebnisse der Recherchen und Modellrechnungen münden in fünf Schlussfolgerungen:
-
«Die Werbebilder und -botschaften der Branche sind irreführend und beschönigen die Schweizer Tierproduktion und ihre Importabhängigkeit. Sie prägen die Vorstellungen der Bevölkerung und erhöhen die Nachfrage nach tierischen Nahrungsmitteln «aus der Schweiz».
-
Die Politik trägt wenig zur Aufklärung der Bevölkerung über die Schweizer Tierproduktion bei. Sie unterstützt die irreführenden Bilder und Botschaften durch die amtliche Terminologie und Berichterstattung. Die Politik begünstigt die Produktions- und Absatzinteressen vor den vielen weiteren gesellschaftlichen Anliegen (z.B. Gesundheit, Umwelt, Tierschutz, Transparenz, volkswirtschaftliche Kosten, Versorgungssicherheit).
-
Von den Futtermittelimporten profitiert nicht die Schweizer Landwirtschaft am meisten. Denn die Landwirtschaft ist für ihr Einkommen nicht nur auf die Produktion angewiesen; sie erhält einkommenssichernde Direktzahlungen. Die Importe sind vielmehr im Interesse der vor- und nachgelagerten Industrien. Sie sind es, die hauptsächlich von einer hohen Tierproduktion zu vergünstigten Preisen profitieren.
-
Die Schweizer Geflügelmast ist ein deutliches Beispiel: Von der Verdopplung der Produktion in den letzten 20 Jahren haben wenige vor- und nachgelagerte Unternehmen, eine Handvoll globaler Zuchtunternehmen und nur ein kleiner Teil der Landwirtschaftsbetriebe profitiert. Die Ausdehnung der Geflügelmast ist eine fragwürdige Entwicklung in der Schweizer Tierproduktion. Durch die Umwelt- und Klimadebatte wird sie noch gefördert, denn Poulet gilt als ressourceneffizient und «klimafreundlich».
-
Als Leitidee für die Zukunft wird vorgeschlagen, die Schweizer Tierproduktion an die lokalen Ökosystemgrenzen in der Schweiz anzupassen und den Konsum der Schweizer Bevölkerung an die globalen Ökosystemgrenzen. Dies würde bedeuten, den Fleischkonsum mindestens zu halbieren.
An dieser Stelle soll nochmals deutlich gesagt werden, dass die biologische und konventionelle Landwirtschaft fast gleichermassen davon betroffen ist. Die von Franziska Herren geführten, eidgenössischen Volksinitiativen «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» (abgelehnt 2020) und die «Initiative für ein sichere Ernährung» (aktuell 2024) sind konkrete und realisierbare politische Ansätze für den Weg hin zu einer Kultur-Landwirtschaft der Zukunft!
Der Mensch und seine Haustiere – die Geschichte einer Jahrtausend alten Beziehung
Unsere Haustiere sind empfindsame seelische Wesen. Sie haben sich durch ihr Leben im Zusammensein mit uns Menschen vom Wild- zum Haustier entwickelt. Wohin mit diesen Wesen, wenn wir sie in Zukunft nicht mehr brauchen?
Zurecht fordern wir heute das Ende der unsäglich leidvollen industriellen Massentierhaltung. In erster Linie ist es eine unwürdige, das Leben und Wesen der Haustiere verachtende Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Die Folgen dieser Tierhaltung und der damit verbundenen Landwirtschaft und Agrarpolitik auf die Umwelt sind heute unbestritten und bekannt: Tierquälerei, Umweltzerstörung durch Wasser- und Luftverschmutzung, Bodenerosion und Zerstörung der autonomen Lebensmittelerzeugung in vielen Ländern der Erde.
Die Haustiere und ihr Wesen gestalteten unsere Vergangenheit mit, sie dienten stets zu unserem Wohle. Wir sollten ihnen also eine würdige Gegenwart und eine lebenswerte Zukunft schenken.
Immer mehr Menschen bevorzugen heute eine vegetarische oder vegane Ernährung. Gleichzeitig zeigt sich in diesem Zusammenhang ein oberflächliches Umweltbewusstsein, mit Forderungen und Vorstellung an die Landwirtschaft und Agrarpolitik, die von Unkenntnis strotzen. Das eigene Verhalten wird hierbei selten gründlich reflektiert. Die Lebensmittelindustrie und Werbung reagieren darauf wie gewohnt schnell und geschäftstüchtig. Vegane und vegetarische Produkte stammen daher oft aus ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoller Produktionsweise und Rohstoffherkunft.
Die Politisierung auf der einen und das unwissend-emotionale Verhalten der Konsumenten auf der anderen Seite verhindert oft eine sachgemässe Behandlung der Problematik. Ein Beispiel für die Politisierung dieses Themas zeigte sich auf der Klimakonferenz, die bis Mitte diesen November im schottischen Glasgow stattfand. Dort haben sich mehr als 100 Staaten zum Methan-Pakt zusammengeschlossen und angekündigt, die Emissionen des Gases zum Ende des Jahrzehnts um mindestens 30 Prozent senken zu wollen.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Biden gaben der Öffentlichkeit das Vorhaben bekannt: «Die Reduktion von Methan sei eines der wichtigsten Dinge, die wir bis 2030 tun können, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten.» Also da wird von Methan gesprochen nicht von CO2!
Damit werden vermutlich genau jene 30 Prozent vom Menschen verursachten Methan-Emissionen angesprochen, die die globale Massentierhaltung erzeugt. Die Fleischindustrie mit einem Marktwert von rund 900 Milliarden Dollar ist ein bedeutender Teil der globalen Nahrungsmittelwirtschaft und sie steht in diesem Zusammenhang vor einem historischen Problem.
Die Lösung liegt auf der Hand: Ganz offensichtlich mit Hilfe der Biotechnologie, und zwar mit In-vitro-Fleisch, das aus den Zellen lebender Tiere gezüchtet wird. Seit einigen Jahren arbeiten weltweit viele Startup-Unternehmen an Alternativen zu Fleisch, Eier und Milchprodukten. Mehrere Milliarden Dollar wurden inzwischen schon in deren Forschung investiert. Unter anderem auch von den weltweit grössten Fleischkonzernen Tyson Foods und Cargill. Da zeigt sich doch flexibles Umweltbewusstsein. Das ist verständlich, denn man geht mit der Zeit und folgt weiter dem Geld.
Wohin mit diesen Wesen, wenn wir sie in Zukunft nicht mehr brauchen? Aussterben lassen? Das ginge sehr lange und wäre zu teuer. In einen Haustierzoo pferchen und von jeder Art ein Paar erhalten, wäre das die Lösung? Denn – wie schon gesagt: Unsere Haustiere sind empfindsame seelische Wesen. Sie haben sich durch ihr Leben mit uns Menschen vom Wild- zum Haustier entwickelt.
Unsere Haustiere, ein beseeltes Kulturerbe – neue Wege für eine gemeinsame Zukunft
Über Jahrtausende waren die Haustiere treue Begleiter des Menschen. Ihre Evolutionsgeschichte hat sich dadurch grundlegend verändert.
Dunkel glänzen ihre Augen aus der Tiefe ihrer Seele. Sie schaut nicht mit den Augen – mit ihrem ganzen Wesen erlebt sie unsere Welt. Ich halte Antigone, die schwarz-weiss gescheckte Kuh, an einem Strick. Sie reibt ihren Kopf an meiner Schulter, leckt mir mit ihrer rauen Zunge über die Hand. Aus ihren Nüstern dampft es warm in den kalten, weiss gekachelten Raum. Der Dorfmetzger setzt ihr den Bolzenschussaparat auf ihre Stirn, dort wo ihr weisser Haarwirbel leuchtet: Ein lauter Knall und Antigone sinkt Sekunden schnell zu Boden. So endet ihr Leben nach 21 Jahren, ein langes friedliches Kuhleben - sie hat mir bis zu ihrem Tod vertraut.
Wer mit Haustieren gelebt und gearbeitet hat, weiss wie es sich anfühlt, dieses unglaubliche Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Diese besondere Art des Vertrauens zwischen Menschen und Haustieren ist das Erbe einer Jahrtausend alten Beziehung. Die besondere Beseeltheit unserer Haustiere, die sich darin zeigt, unterscheidet sich wesentlich von jener der Wildtiere. Dieser Unterschied ist die Folge ihres Lebens, Seite an Seite im Sozialgefüge des Menschen. Den Haustieren wie den Wildtieren gebührt deshalb eine wesensgerechte Zuwendung.
Unsere heutige Welt hat sich diesbezüglich fundamental geändert. Die Haustiere wurden Stück für Stück aus unseren sich auflösenden organischen Gemeinschaftsformen entlassen. Wir leben nicht mehr mit, sondern gegen die Natur. Unsere Ansichten und Vorstellungen gegenüber den Haustieren tönen heute unter andrem so: Die Kühe und Schweine sind Klimakiller, Schafe und Ziege sind ökotaugliche Rasenmäher für landschaftspflegende Massnahmen, das Pferd fristet ein kurioses, aber doch dekoratives Dasein bei betuchten Pseudobauern.
Im öffentlichen Diskurs über Tierhaltung, Klimawandel und Umweltschutz zeigt sich ein realitätsfremdes, emotional aufgeladenes Schwarzweis-Denken. Dies lenkt von den wahren Ursachen der Missstände ab. Unsere Haustiere sind zu buchhalterischen Faktoren mutiert. Das Resultat ist Massentierhaltung: Das Tierwohl wird missachtet, die Natur wird massiv belastet.
Brauchen wir also unsere Haustiere noch? Ich behaupte ja, denn wir haben noch eine lange gemeinsame Zukunft vor uns. Und dies nicht wegen der Wurst auf dem Grill. Wie könnte also der nächste Schritt auf diesem Weg dahin aussehen?
Unsere Haustiere als beseelte Wesen wertschätzen, wäre der erste Schritt auf diesem Weg. Wir müssen ihre Stellung innerhalb unserer gemeinsamen kulturgeschichtlichen Entwicklung anerkennen und würdigen. Dies bildet die Grundlage in der Auseinandersetzung mit den damit verbundenen ethischen Fragen: zum Beispiel die Frage nach der Form ihrer Nutzung und im Besondern die Frage nach der Tötung unserer Haustiere, die unvermeidbar damit verbunden ist. Ihr Leben beginnt mit der Geburt und endet mit ihrem Tod.
Das Wesentliche dabei ist, wie sich diese Dreiheit, sprich Geburt, Leben und Tod, auf ihr Seelenleben auswirkt – war es friedlich oder qualvoll? – denn das Seelische existiert weiter. Haben wir dieses Faktum einmal verinnerlicht, sprich gefühlt im Herzen und erkannt durch ein wesensgemässes Studium der Natur, dann eröffnen sich ungeahnte neue Wege für eine gemeinsame Zukunft.
(1) Schweizer Futtermittelimporte – Entwicklung, Hintergründe, Folgen. Priska Baur, Patricia Krayer. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Wädenswil 2021
Kultur-Landwirtschaft
von Andreas Beers
Inhalt
Kapitel 1: Was wir zum Leben brauchen
Kapitel 3: Die Erde, unsere Heimat
Kapitel 4: Historische Betrachtungen
Kapitel 6: Die Tierhaltung in der Landwirtschaft
Kapitel 7: Warum Kultur-Landwirtschaft
Kapitel 8: Hand anlegen – gewusst wie
Kapitel 9: Und zum Schluss - was wir tun können, jetzt sofort





