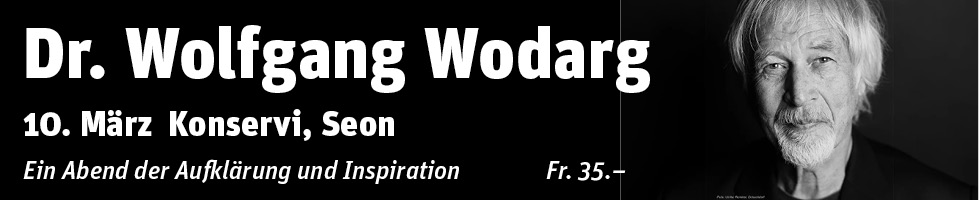Während ich auf die siebenstelligen Schecks von Investoren warte, die sich auf mein Schreibmaschinenprojekt stürzen, möchte ich noch ein paar weitere Gedanken zur Rückgewinnung des Lebens aus der Digitalisierung äussern.
Meine Sehnsucht nach Schreibmaschinen und Füllfederhaltern ist nicht nur Nostalgie. Sie entspricht auch einem realen Verlust von Fähigkeiten, einer Verflachung und Entmutigung des Lebens und dem Wunsch, den verborgenen Funken von Vitalität wieder zu entfachen.
Ich habe festgestellt, dass das Schreiben am Computer mein Denken beeinträchtigt. Wenn ich mit der Hand oder der Schreibmaschine schreibe, muss ich den ganzen Satz oder Absatz planen, bevor ich ihn schreibe. Denn wenn ich mich in eine Sackgasse hineinschreibe, kann ich nicht so leicht löschen, ändern oder ausschneiden und einfügen. Wenn ich am Computer schreibe (wie jetzt), kann ich sorglos und in kürzeren Abschnitten denken. Zum Beispiel dieser letzte Satz – als ich mit «Schreiben am Computer» begann, wusste ich noch nicht genau, wie ich den Satz beenden würde. Ich ging sogar zurück und änderte die ursprüngliche Version.
Wenn ich mit der Hand schreibe, mache ich längere Pausen zwischen den Ideen, damit ich sie zu Ende denken kann, bevor ich sie zu Papier bringe. Das erfordert auch eine längere Konzentrationsspanne. Ich muss in einem bestimmten Moment mehr im Kopf haben. Wenn ich das nie tue, verkümmert diese Fähigkeit.
Natürlich braucht man beim Schreiben mit der Hand oder der Schreibmaschine viel mehr Zeit, nicht nur für den ersten Entwurf, sondern auch für Überarbeitungen und Korrekturen. Es ist weniger effizient. Effizienz ist generell das Motiv für die Digitaltechnik. Der Computer war in seinen Anfängen ein Werkzeug zur schnellen Durchführung von Berechnungen. Die ersten Computer waren Rechenmaschinen.
Im Prinzip könnte der Mensch die Aufgaben erledigen, die Computer ausführen, wenn er nur genügend Zeit hätte (im Falle der Klimamodellierung oder des 3D-Video-Rendern Äonen), denn im Grunde handelt es sich nur um die Manipulation von Nullen und Einsen. Praktisch gesehen erweitern Computer und insbesondere die künstliche Intelligenz unsere Reichweite auf sonst unerreichbare Ziele. Aber diese Erweiterung hat einen hohen Preis, den wir verstehen müssen, wenn wir nicht die Hölle auf Erden schaffen wollen. Ich wähle diese Worte mit Bedacht. Lassen Sie mich erläutern, was ich meine.
Das Konzept der Effizienz – wie viel man pro Zeiteinheit (oder pro Dollar usw.) erreichen kann – sagt uns nichts über Ergebnisse, die wir nicht quantifizieren oder messen können. Wenn wir unsere Gesellschaft auf Effizienz ausrichten, produzieren wir mehr und mehr Messbares, während das Unmessbare, das Qualitative und die Dinge, die wir nicht zu messen gedenken, verschwinden. Im Rausch des quantitativen Überflusses können wir vielleicht nicht sehen, was verloren geht, aber wir können seine Abwesenheit durchaus spüren.
Die erste bedeutende Industriemaschine – der elektrische Webstuhl – konnte in einer Stunde tausendmal mehr Stoff weben als ein Mensch. Autos und Flugzeuge haben die Anzahl der Kilometer, die ein Mensch in einer Stunde oder in seinem Leben zurücklegen kann, enorm erhöht. Künstliche Intelligenz kann in wenigen Minuten Millionen von Gedichten produzieren. Mit Synthesizern kann ein Mensch Songs viel schneller produzieren und hochladen, als eine Band oder ein Orchester zum Üben und Spielen brauchen würde; KI beschleunigt diesen Prozess noch um ein Tausendfaches.
Bei jedem dieser Effizienzsprünge verlieren wir etwas, das wir vielleicht erst später erkennen, wenn überhaupt. Beim Autofahren (und noch mehr beim Fliegen) verschwinden die Orte zwischen hier und dort. Unser Leben wird zu einer Aneinanderreihung von Zielen, die durch dieselbe grundlegende Reiseerfahrung verbunden sind. Wenn wir hingegen mit biologischer Geschwindigkeit unterwegs sind, etwa zu Fuss oder auf dem Pferderücken, können wir die Abfolge von besonderen Pflanzen und Tieren, Hügeln, Landschaften, Gerüchen und Geräuschen auf dem Weg wahrnehmen. Eine Reise wird zu einer Abfolge von zusammenhängenden Orten. Das Leben erhält mehr Textur und Kontinuität, mehr Sinn und mehr körperliche Nähe. Wenn man sich von einem Ort zum anderen bewegt, geht es nicht nur um den Ort, sondern auch um die Anstrengung. Während der Fahrt im Auto oder im Flugzeug hat der Körper nicht das Gefühl, dass er irgendwo hinfährt, und doch ist man plötzlich an einem neuen Ort. Es entsteht eine Trennung zwischen Körper und Geist, die beiden schadet und andere Formen der Trennung begünstigt. Es ist ein Vorbote des Abstiegs – oder sollte ich sagen Aufstiegs? – in die digitale Welt, in der der kinästhetische Sinn von den visuellen und auditiven Sinnen abweicht. Auf dem Bildschirm passiert so viel, doch der Körper bleibt still. Die Online-Abenteuer der Videospiele finden in völliger körperlicher Stille statt.
Das Eintauchen in die digitale Welt bringt eine Verarmung mit sich, die im Widerspruch zu ihrem scheinbaren Überfluss zu stehen scheint. In der digitalen Welt kann man überall hingehen, alles haben und alles tun. Man kann Websites «besuchen». Man kann im Internet «surfen». Man hat die Illusion von unbegrenzter Freiheit. Doch all diese digitalen «Erfahrungen» sind in der Unbeweglichkeit enthalten. Daher erfüllt keine von ihnen das verkörperte Bedürfnis zu gehen, zu reisen, etwas zu riskieren oder zu spielen.
Der digitale Überfluss treibt die Armut, die der industriellen Massenproduktion bereits innewohnt, auf die Spitze. In diesem Moment betrachte ich ein Bettlaken. Es hat ein hübsches Muster mit Vögeln und Farnen darauf. Jemand muss ewig gebraucht haben, um das zu weben. Natürlich nicht wirklich. Eine Maschine hat es in Sekundenschnelle hergestellt. Es stimmt, eine Reihe von Ingenieuren hat diese Maschine und ihre Vorläufer entworfen; andere haben die Traktoren entworfen, die die Baumwolle geerntet haben, und unzählige Arbeiter haben diese Maschinen bedient. Aber keiner von ihnen befindet sich in meinem Umfeld. Keiner von ihnen ist mit mir in irgendeiner Weise verbunden, ausser durch den Kauf der Maschine. Keiner von ihnen kümmerte sich um mich persönlich. Niemand hat dieses Laken für mich hergestellt. Es ist ein allgemeiner, unpersönlicher und fremder Gegenstand – und deshalb billig. Es kann immer noch wertvoll werden, wenn es sich abnutzt und Flecken bekommt und eine Geschichte von Gebrauch und Beziehung annimmt, aber am Anfang ist es billig.
Armut entsteht, weil einige viel mehr haben, als sie brauchen, und den Rest durch Schulden und Gewalt enteignen. Warum tun sie das? Weil auch sie verarmt sind – nur nicht an dem, was man mit Geld kaufen kann.
Gewiss, billig ist besser als gar nichts. Billige Kalorien sind besser als keine Kalorien. Besser ein Dach über dem Kopf als unter einem von Bomben zertrümmertes Dach zu hausen, das man nicht verlassen kann. Viele Menschen auf dieser Erde leiden unter einer quantitativen Armut, nicht nur unter der qualitativen Armut, von der ich spreche. Aber ihre quantitative Armut ist nicht das Ergebnis eines tatsächlichen Mangels, sondern einer Fehlverteilung. Sie entsteht, weil einige viel mehr haben, als sie brauchen, und den Rest durch Schulden und Gewalt enteignen. Warum tun sie das? Weil auch sie verarmt sind – nur nicht an dem, was man mit Geld kaufen kann.
Die moderne Gesellschaft entschädigt uns für diesen Mangel an Einzigartigkeit, Beziehung, Intimität und Qualität durch eine endlose Ausweitung der Quantität. Reichtum für eine Person oder eine Nation bedeutet, mehr zu haben. Das ist unvermeidlich, wenn wir uns Reichtum als etwas vorstellen, das man messen kann. Ironischerweise liegt also der Ursprung der Armut in dem grundlegenden Massstab für Reichtum, dem Geld. Geld hat keinerlei Körperlichkeit. Es trägt noch weniger Spuren von seiner Geschichte und seinen Beziehungen als eine Fabrikware. Es ist ein reines Symbol.
In einer monetarisierten Gesellschaft ist man mit Geld reicher als ohne. Aber selbst der Geldreichste ist in den meisten Fällen ärmer als ein Jäger und Sammler, ein traditioneller Viehzüchter, ein abgelegener Dorfbewohner oder jemand, der in «Erinnerungskulturen» lebt, wie Orland Bishop es nennt. Besucher der Hadza, der Quero oder Kogi oder anderen abgelegenen, auf Geschenken basierenden Gesellschaften werden das bestätigen.
Es ist kein Wunder, dass eine Gesellschaft, die darauf konditioniert ist, Geld als das richtige Mass für Reichtum zu akzeptieren, auch den digitalen Reichtum (der im Grunde auch ein reines Symbol ist, Nullen und Einsen) als Ersatz für das verkörperte Leben akzeptiert.
So steigen wir hinab (oder wieder «hinauf», denn es handelt sich um eine Entmaterialisierung und nicht um ein Versinken im Boden) in die Hölle, von der ich spreche. Es ist ein Übergang in eine degradierte Ebene der Realität. Wir werden dazu verleitet, weniger real zu werden.
Das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich einmal nach der Einnahme einer psychedelischen Droge gemacht habe. Als die Wirkung der Substanz einsetzte, hatte ich kurzzeitig das Gefühl, mich an einem winzigen Stück Papier festzuhalten, das ich zwischen Finger und Daumen hielt und auf dem «Charles Eisenstein» stand. Als ich mich daran klammerte, dachte ich: «Was auch immer geschieht, es ist nicht real, es sind nur Chemikalien in meinem Gehirn.»
Aber als der psychedelische Wirbelsturm es mir aus der Hand riss, waren meine letzten Worte an mich selbst: «Nein. DAS war nicht real.» Charles Eisenstein war nicht real. Meine gesamte Identität war nicht real. Und so verbrachte «ich» eine zeitlose Zeit in einer viel realeren Realität. Dann kam ich zurück in diese blassere Realität, in die Inkarnation als Charles. Ich vertraue darauf, dass ich mich aus Gründen inkarniert habe, die meine Seele kennt, auch wenn «ich» sie manchmal in Frage stelle. Glücklicherweise kann sich niemand von uns hier dauerhaft verlieren, denn es gibt eine vorprogrammierte Sicherung: Wir nennen sie Sterben.
Das Eintauchen in die digitale Realität fühlt sich ähnlich an wie der Abstieg in eine blassere Realität, aber ich bezweifle, dass wir dabei die gleiche Weisheit anwenden wie bei der Wahl einer Inkarnation. Die Technologen, die davon fantasieren, Unsterblichkeit zu erlangen, indem sie ihr Bewusstsein in Computer hochladen, streben in Wirklichkeit nach einer Hölle, die den oberflächlichen Exzess und die innere Leere des modernen Lebens noch verstärkt. Können Sie sich eine Realität vorstellen, in der Sie, nachdem der Reiz des Neuen verblasst ist, nichts weiter haben als diese ewige Freudlosigkeit aus Pixeln und Bits?
Willkommen, willkommen, willkommen – in der Maschine! Das Lied von Pink Floyd berührt mich immer wieder. Aber wenn ich es tausendmal hören würde, endlos, in verschiedenen Kombinationen, wäre es der Soundtrack zur Hölle.
Damit soll nicht gesagt werden, dass wir Menschen die Technologien, die unser Leben effizienter machen, ablehnen sollten. Wir müssen nur erkennen, welche Bedürfnisse durch eine grössere Quantität erfüllen werden und welche nicht. KI-Chatbots können zum Beispiel nicht das Bedürfnis nach Intimität befriedigen. KI-generierte Kunst kann das Bedürfnis nach ästhetischer Nahrung nicht befriedigen. Ja, diese Simulationen stillen unser Bedürfnis, aber nur vorübergehend.
Diejenigen, die etwas anderes glauben, gehen von der Vorstellung aus, dass Zahlen letztlich alles erfassen können. Wenn das so ist, dann ist eine perfekte Simulation von Intimität, Schönheit und Liebe möglich.
Wenn ich jedoch Recht mit der Aussage habe, dass die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse für immer jenseits der Möglichkeiten digitaler Technologien liegen, dann können wir diese Bedürfnisse als dauerhafte Quelle wirtschaftlicher, sozialer und spiritueller Entwicklung betrachten. Unsere Maschinen können uns niemals ersetzen – vorausgesetzt, wir erkennen die Grenzen dessen an, was sie tun können, und würdigen die Bedeutung dessen, was sie nicht tun können. Das bedeutet, dass eine Zukunft mit Massenarbeitslosigkeit keineswegs unvermeidlich ist. Wir werden reichlich Gelegenheit haben, schöne Arbeit zu verrichten, wenn wir als Gesellschaft ihre Früchte schätzen.
Nicht nur die Früchte, sondern auch der Prozess der Arbeit birgt eine Art von Reichtum, der sich der Effizienz entzieht. So wie Flugreisen die Trennung von den Orten zwischen Start und Ziel mit sich bringen, so entfremdet uns auch die mechanisierte, verteilte und anonyme Produktion von der materiellen Welt. Es mag wie ein privilegierter Genuss erscheinen, sich Zeit zu nehmen, um beispielsweise eine Mütze zu stricken, die funktionell nicht besser ist als eine 5-Dollar-Mütze von Wal-Mart. Aber eine Mütze zu stricken bedeutet, die Orte zwischen Material und Produkt zu besuchen, mit dem Terrain der Materialität vertraut zu sein und sich deshalb darin wohler zu fühlen.
Meine Frau Stella liest gerade ein Buch über das Leben nach dem Tod. Der verstorbene Sohn der Autorin beginnt, aus dem Jenseits zu ihr zu sprechen und beschreibt, wie es dort ist. Im Jenseits, sagte er, kann man mit einem Gedanken alles manifestieren, was man will. Eine Hütte im Wald, zum Beispiel. Man muss nicht erst das Grundstück finden, die Materialien besorgen, das Fundament ausheben, die Pfeiler aufstellen, die Bretter abmessen und so weiter. Man «manifestiert» sie einfach. Das klingt schön, aber in welchem Sinne gehört die Hütte dann Ihnen? Sie ist nicht aus einer Beziehung entstanden, die Arbeit und Aufmerksamkeit erfordert. Sie ist einfach erschienen, ein fremdes Objekt. Das erinnert mich sehr an die Dinge, die ich jeden Tag «manifestiere»: Ich brauche nur meinen Computer zu öffnen, mit den Fingern zu schnipsen, und voilà – ein Satz Bettlaken erscheint in meiner Auffahrt. Ich fühle wenig Anhaftung an Dinge, die mir so leicht fallen. Und wenn ich eine Hütte in einem Augenblick ohne Arbeit manifestieren könnte, würde ich mich auch nicht an sie gebunden fühlen. Es wäre ein Wegwerfartikel. Dies gilt umso mehr für digitale Objekte, wie von KI generierte Lieder, Gedichte und Bilder.
Der Sinn dieses ganzen Aufenthaltes in der materiellen Welt ist es, sich zu binden.
Ungebundenheit mag als Tugend erscheinen. Aber die Abkopplung von den Prozessen, mit denen unsere Bettlaken und alles andere produziert werden, ermöglicht es uns auch, die schwerwiegenden ökologischen und sozialen Folgen zu ignorieren. Wenn mir jemand eine Decke schenkt, die er in mühevoller Kleinarbeit selbst gewebt hat, wenn ich Zeuge anderer solcher Webarbeiten geworden bin, dann erkenne ich sie als wertvoll an.
Das gilt auch für den Rest des Lebens. Es ist wertvoll, weil es so viel Sorgfalt erfordert, um es aufzubauen. Der Sinn dieses ganzen Aufenthaltes in der materiellen Welt ist es, sich zu binden. Warum wir die geistige Welt überhaupt verlassen? Oder warum hat Gott uns hierher geschickt? Es geht darum, die Seele auf die Art und Weise zu entwickeln, die in dieser Welt einzigartig ist. Es geht darum, unsere Gaben in die Schöpfung einzubringen. Es geht darum, Bindungen aufzubauen und unseren Beitrag zur Schöpfung wertvoll zu halten. Es geht darum, Beziehungen zu Menschen und Materie aufzubauen, Beziehungen, die uns wachsen lassen, Beziehungen, die immer in Trauer enden, weil sie nicht ewig dauern können. Wir sind hier, um zu lieben, um zu verlieren und um wieder zu lieben. Deshalb fühlen wir uns weniger gegenwärtig, weniger lebendig und hungrig nach etwas, das die Konsumkultur nicht benennen kann, wenn sich das Leben mit Gegenständen füllt, die mit wenig Aufwand zu erlangen sind.
Konsumverlangen wird durch ein unerfülltes schöpferisches Verlangen genährt. Wir suchen Intimität – mit der Materie – und bekommen stattdessen eine Abfolge neuer Beziehungen. Die Unerfülltheit des Konsumverhaltens fühlt sich ähnlich an wie die von Gelegenheitssex. Der menschliche Sexualtrieb strebt nach mehr als nur momentaner Befriedigung. Er strebt nach Bindung. Er will etwas schaffen. Er strebt nach Beziehung. Er sucht nach Familie.
Ein grosses Paradoxon des modernen Lebens ist, dass wir trotz seiner beispiellosen Effizienz, trotz der jahrhundertelangen Erfindungen, die uns Zeit sparen sollen, weniger Zeit haben als je zuvor.
Ein Freund von mir ist extrem reich – er ist Mehrheitsaktionär eines milliardenschweren Unternehmens. Sein Grossvater lebt in einem Pflegeheim. Mein Freund macht jeden Tag Frühstück für seinen Grossvater und fährt es selbst zum Pflegeheim, um es ihm zu bringen. Er könnte leicht jemanden anstellen, der das alles macht. Aber weiss, was echter Reichtum ist. Die geistige Dividende aus seiner «Investition» in seinen Grossvater ist eine Art von Reichtum, den kein Feuer verbrennen und kein Dieb stehlen kann.
Viele Menschen, die von Armut geplagt sind und zwei Jobs verrichten müssen, haben vielleicht nicht den Luxus, sich um ihre eigenen alten Grosseltern zu kümmern. Vielleicht nichtmal um ihre eigenen Kinder. Eine Tagespflege ist vielleicht die einzige finanziell tragbare Option. Aber das ist die Folge unseres Systems, nicht eine grundsätzliche Knappheit an Ressourcen. Das war nicht immer so. Ein grosses Paradoxon des modernen Lebens ist, dass wir trotz seiner beispiellosen Effizienz, trotz der jahrhundertelangen Erfindungen, die uns Zeit sparen sollen, weniger Zeit haben als je zuvor. Wir sind die erste Kultur in der Geschichte, die so zeit-arm ist, dass Millionen von uns nicht in der Lage sind, die kostbarsten und intimsten Momente des Lebens zu geniessen. Diese Armut des Heiligen ist das Ergebnis der Besessenheit vom Messbaren.
Sie ist auch in unser Finanzsystem eingebaut, in dem Geld als zinstragende Schuld entsteht und dessen endlose Vermehrung (genannt «Wirtschaftswachstum») notwendig ist, damit das System funktioniert. Dieser systemische Zwang zu immer mehr und mehr und mehr deckt sich mit der ideologischen Betonung von Quantität und Messbarem.
Es gibt einen anderen Weg. Er besteht nicht darin, vorsätzlich weniger effiziente Mittel einzusetzen, um den Output der Maschine zu kopieren. Es geht darum, zu erkennen, zu priorisieren und wertzuschätzen, was die Maschine nicht zu produzieren vermag. Dabei geht es um einen systemischen und einen persönlichen Aspekt. Beide stützen sich gegenseitig. Über den systemischen Aspekt habe ich in Sacred Economics ausführlich geschrieben. Was den zweiten Aspekt betrifft, so können wir als Einzelne etwas von dem zurückgewinnen, was verloren gegangen ist: Nicht nur indem wir wieder Dinge für uns selbst machen und tun; viel wichtiger ist es, Dinge für andere zu machen und zu tun, für Menschen, die wir kennen, für Menschen, die auch für uns Dinge machen und tun. Dann wird keiner von uns mehr so sehr in einer fremden Welt leben.
«Maschinen werden uns nicht ersetzen» ist keine Vorhersage. Es ist eine Erklärung.
Übersetzt von: Christa Dregger
Lesen Sie im Zeitpunkt auch:
Unser Heft zur Künstlichen Intelligenz - November 2023
Neues Gesetz zur künstlichen Intelligenz in der EU: ein «Rechtsversagen»?