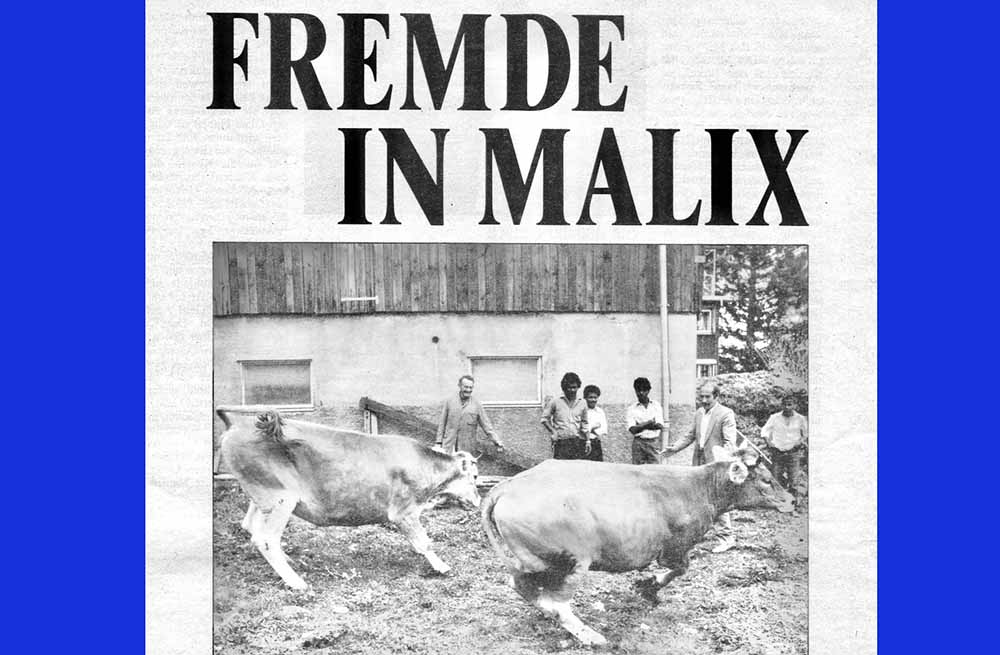Teil 1: Fremde in Malix
III
In der Malixer Dorfbeiz am frühen Abend. Ich sitze am Tisch mit vier Einheimischen: Schocher, ein älterer Bauer, Caspescha, der Schreiner, Fredi Walser, ein junger Verkaufsberater, Alfred Kessler, Gemeindepräsident.
Vom Nebentisch klirren die Bierhumpen. Fünf deutsche Zimmerleute prosten sich zu. In ihrer schwarzen Tracht, mit ihren lauten germanischen Trinksprüchen nehmen sie sich mehr Platz als die schmächtigen Asylanten, die sich gelegentlich für ein Bier in die Dorfbeiz hineingetrauen. Aber das Gasthaus an der Hauptstrasse ist seit Jahren bekannt als Absteige für Hamburger Wandergesellen. Die Zimmerleute sind für die Malixer kein fremder Anblick, man hat sich an sie gewöhnt. Man kennt ihre Herkunft. Man kann deutsch und deutlich mit ihnen reden. Sie wissen, was Arbeiten heisst. Und nach ein paar Wochen ziehen sie weiter.
Über die Asylbewerber wollen wir reden. Fredi Walser, der junge Malixer, zeigt zum Fenster hinaus auf die andere Seite des Tales. «Da drüben verläuft der Polenweg», erklärt er mir. Polnische Internierte im letzten Krieg hätten den Weg gebaut. Für ein Sackgeld!
«Warum können die Flüchtlinge für so etwas nicht eingesetzt werden? Statt dass sie den ganzen Tag die Zeit totschlagen müssen?»
Die Tischrunde erwägt das Für und das Wider. Man findet die Idee nicht sehr realistisch. Das könne man heute nicht mehr machen. Die Asylanten würden sich weigern, für ein Taschengeld anzupacken.
Der Gemeindepräsident, der als Ingenieur beim Kanton arbeitet, sieht das Problem mehr von der praktischen Seite: Er weiss im Augenblick keine Beschäftigung für die Asylanten. Wenn es im Dorf etwas zu tun gibt, muss man zuerst die Menschen im Dorf berücksichtigen, ältere Männer, die froh sind um eine Arbeit. Oder Betriebe im Unterland, die einen Einsatz im Berggebiet planen. Dann schicken sie ihre Lehrlinge nach Malix.
«Aber noch etwas kommt dazu», meint der Gemeindepräsident. «Einen Weg bauen, das können die Tamilen nicht. Die sind für so etwas viel zu ungeschickt.»
Der Satz bleibt stecken wie ein hässliches Vorurteil. Doch der Schreinermeister pflichtet dem Präsidenten bei: Seit ein paar Wochen beschäftigt er einen Tamilen bei sich. Er zahlt ihm nur den Minimallohn – aber eigentlich sei auch das schon zuviel.
«Der Mann ist einfach zu langsam. Man muss ihn ständig antreiben. Man muss ihm alles dreimal erklären. Das ist kein Schaffen auf diese Art.»
Der Bauer Schocher hat seinen Stall neben dem Flüchtlingsheim oben. Manchmal kommen die Asylanten und schauen ihm bei der Arbeit zu. Aber nur die wenigsten haben sich anerboten, zu helfen. Der Bauer nimmt es ihnen nicht einmal übel. «Die haben eine völlig andere Lebensauffassung», sagt er. «Für sie ist die Arbeit nicht selbstverständlich, das merkt man. Sie arbeiten nur, wenn sie müssen, und nur, wenn sie etwas verdienen.»
Dann fügt er hinzu: «Es ist von Grund auf verkehrt, diese Menschen bei uns integrieren zu wollen. Das geht nicht zusammen. Die wären besser daheim geblieben. Das ist sowieso nicht das Richtige, wenn man zuhause davonläuft und das Vaterland einfach im Stich lässt.»
Mit einem einzigen Satz hat der Bauer aus Malix die ganze komplexe politische Situation auf Sri Lanka oder in der Türkei einfach vom Tisch gewischt: Man lässt das Vaterland nicht im Stich.
Aber im Handkehrum erzählt derselbe Bauer, dass er den Tamilen hier in der Dorfbeiz auch schon eine Runde spendiert hat. Und wenn er mit seinem Traktor zum Stall hinauffährt, hat er die Asylanten noch jedesmal mitgenommen!
Das Thema, was wir behandeln, ist nicht harmlos. Man spürt, da liegt viel Unausgesprochenes in der Luft. Der Schreiner spricht es zuerst aus:
«Für die Türken und die Tamilen tun sie alles, aber uns, den Gewerblern, machen sie das Leben schwer, die Behörden. Wir zahlen Steuern, damit die Asylanten nachher im Sonntagsgewand durchs Dorf spazieren. So ist es doch.»
Von den Kleidern der Asylanten reden viele, hier in Malix, das schlucken sie nicht, dass die Bedürftigen aus der Dritten Welt schönere Sachen tragen als manche Einheimische. Die meisten Kleider für die Asylbewerber stammen aus Restbeständen, die das Heim billig erworben hat. Aber die jungen Männer wissen sich anzuziehen: Geschmackvoll, farbenfroh, ein wenig auffällig – zu auffällig für die Werktage in einem Bergdorf.
«Ich bin Unternehmer», sagt der Schreinermeister, «aber was soll ich mit dem Sonntagsgewand? Unter der Woche trage ich Arbeitskleider.»
Das ist es: Die Asylanten arbeiten nicht. Warum arbeiten sie nicht? Wir arbeiten doch auch! – Die Arbeit ist die Hauptsache. An seiner Einstellung zur Arbeit wird der Fremde gemessen. So sind wir Schweizer.
Unmut kommt zum Vorschein am Tisch in der Dorfbeiz. Der Bauer ergreift das Wort: «Da lässt man diese Asylanten herein, und wir, die Landwirte, müssen unsere Höfe aufgeben, weil das Geld nicht reicht. Früher einmal gab es fünfzig Bauern in der Gemeinde. Jetzt sind wir noch unser zehn.»
«In der Gegend hier», sagt der junge Verkaufsberater, zu mir gewandt, «leben Einheimische, die es wahrscheinlich gerade so nötig hätten wie die Asylanten. Ich weiss von Familien, die müssen jeden Rappen umdrehen, aber die machen aus ihrer Armut kein Drama. Die würden das Geld vom Staat zum Teil gar nicht nehmen.»
Die Malixer wollen keine Almosen. Man muss arbeiten für das Geld. Die Asylanten begreifen das nicht. Sie begreifen nicht, warum man sich das Geld in der Schweiz verdienen muss, wo es doch auf der Strasse liegt. Die Fremden aus der Dritten Welt und die Einheimischen leben im gleichen Dorf – und sind immer noch Tausende von Kilometern voneinander entfernt.
Ich frage die Malixer am Tisch, wie die Gemeinde entscheiden würde, wenn sie über das Flüchtlingsheim abstimmen könnte. Der Gemeindepräsident schätzt, eine Mehrheit würde das Heim akzeptieren. Der Schreinermeister indessen ist überzeugt, eine Mehrheit wäre dagegen. Der Präsident ist erstaunt: Bis jetzt habe man keine ernsthaften Schwierigkeiten gehabt, stellt er fest. An den Gemeindeversammlungen sei das Asylantenheim noch nie ein Traktandum gewesen. Der Schreiner jedoch bleibt bei seiner Überzeugung. «Die Leute reden hintenherum. Da hört man einiges.»
Für einen Augenblick wird es ruhig an unserem Tisch. Bis jetzt gab es keine grossen Probleme, das stimmt. Aber vielleicht hat der Schreiner recht. Vielleicht braucht es wenig. Ein kleiner Vorfall würde genügen, ein Diebstahl, eine Belästigung, ein Verdacht: Dann wäre kein Friede mehr in Malix.
IV
Ein zweiter Besuch im Flüchtlingsheim, am nächsten Morgen. Die Tamilen haben mich eingeladen, an einer Gedenkfeier teilzunehmen.
Bei meiner Ankunft sind sie alle schon im Gemeinschaftsraum zusammengekommen. An den zur Seite geschobenen Tischen sitzen ein paar Kurden, würfeln um eine Handvoll Glück und werfen hin und wieder skeptische Blicke zu den Tamilen. Vorne am Fenster, auf einem weissgedeckten, feierlich geschmückten Tisch, steht ein verhülltes Bildnis, von Kerzen umgeben. Einer der Asylanten entzündet die Kerzen. Es wird still im Raum, nur das Geräusch der fallenden Würfel ist zu vernehmen. Der Tamile bittet die Kurden mit einer Handbewegung, ihr Spiel zu unterbrechen.
Dann, wie auf Kommando, erheben sich alle zu einer Schweigeminute. Auch ich stehe auf, obwohl ich nicht weiss warum, auch die Kurden stehen auf, zögernd, ein wenig verlegen, stehen wir da, mitten im Bündnerland, Moslems, Hindi, Christen, und verharren im Schweigen.
Marc, der Heimleiter, wird gebeten, das Bild zu enthüllen. Es zeigt – in Gold gerahmt – die Fotografie einer älteren Frau, und darunter, zuerst in tamilischer, dann in deutscher Schrift die Worte:
Unsere Flüchtlingsmutter – Margrith Zwicky.
Der Tamile hält in seiner Muttersprache eine kleine Rede, dann übergibt er dem Heimleiter das Wort, der sich auf Deutsch an die Zuhörer wendet. Er spricht langsam, in möglichst einfachen Sätzen, und erzählt von dieser Frau, Margrith Zwicky, die in Malix gelebt hat und vor kurzem verstarb.
Das Heim war gerade eröffnet worden, als Frau Zwicky zum erstenmal zu Besuch kam. Sie brachte Selbstgebackenes mit und verteilte den Asylanten Gutscheine für eine Tasse Tee bei ihr zu Hause im Dorf. Die Kurden blieben zurückhaltend, die Tamilen jedoch folgten der Einladung – einmal, zweimal und immer wieder. Sie schlossen die Frau in ihr Herz, ja, sie verehrten sie und nannten sie ama, was «Mutter» heisst. Frau Zwicky nahm sich Zeit für die Männer, sie gab ihnen Deutschunterricht, sie half ihnen bei der Suche nach Arbeit, sie umsorgte und ermutigte sie.
Die Dorfbewohner beobachteten das Engagement der Frau Zwicky mit Respekt und Anerkennung. Manche wunderten sich freilich im Stillen, dass die Schweizerin für diese Fremden soviel Verständnis aufbringen konnte. Sie selber konnten es nicht – sie hatten mit ihrem eigenen Leben genug zu tun.
Niemand wusste, dass die Tage von Margrith Zwicky gezählt waren. Eines Morgens, ganz überraschend, wurde im Dorf die Nachricht von ihrem Tode bekannt. Unten in Chur wurde die Verstorbene zu Grabe getragen. An der Abdankung nahmen ihre Schweizer Angehörigen, einige Dorfbewohner – und fast 30 Tamilen teil. Die dunkelhäutigen Fremden gaben der Malixerin das letzte Geleit.
Malix ist heute politisch kein eigenständiges Dorf mehr, sondern gehört seit 2009 zur Gemeinde Churwalden. Zuletzt betrug die Einwohnerzahl 730 Personen. Asylbewerber wohnen keine mehr in Malix. Das Durchgangsheim wurde bereits in den 90er Jahren geschlossen, zugunsten anderer Unterkünfte in der Region. 2022 wurde, ebenfalls in der Gemeinde Churwalden ein Erstaufnahmezentrum für Migranten eröffnet. Es kann bis zu 180 Personen aufnehmen.
Die Ur-Fassung dieser Reportage erschien im Oktober 1987 in der «Schweizer Illustrierten».