Die «Wurzelbehandlung» ist Ursachenbehebung, nicht Symptombekämpfung. Was wir aktuell hauptsächlich mit unserer Agrarpolitik veranstalten, ist «an den Früchten der Agrarindustrie herumschnitzen». Die Bauern in der Schweiz mit ihren Verbänden und Wirtschaftsvertretern demonstrieren und werben um ihr Ansehen, nicht für eine wesensgemässe Landwirtschaft.
In der aktuellen Agrardebatte wird fantasiert, kalkuliert und vorgerechnet – es werden Ziele formuliert mit Begriffen, welche mit dem Kern der Urproduktion nichts mehr zu tun haben. Trendige Begriffe aus der industriellen Agrarwirtschaftssprache, wie Produktivität, Wettbewerb und Effizienz, werden gebetsartig wiederholt und führen die Landwirtschaft immer weiter in die Sackgasse. Die hochtechnisierte Landwirtschaft schafft es trotz immensem Energie- und Ressourcenverschleiss nicht, für eine solide, ökologisch und sozial sinnvolle Lebensmittelversorgung zu sorgen. Die reale Lebensmittelversorgung in der Schweiz liegt aktuell bei rund 40%.
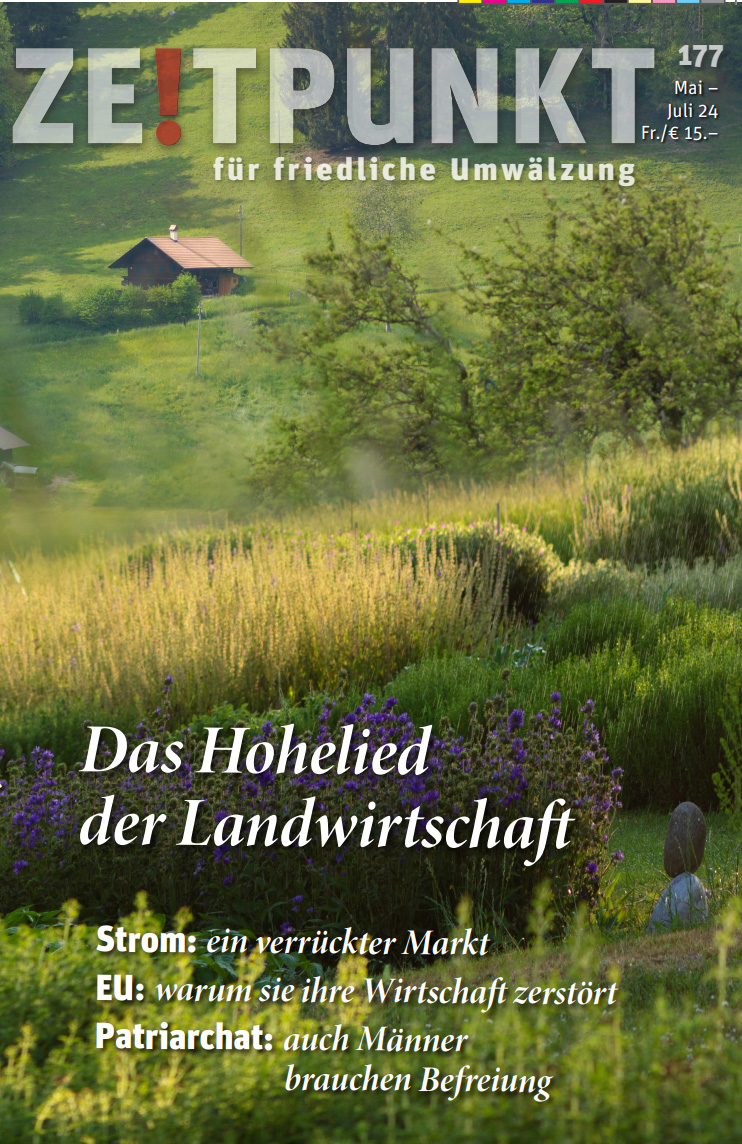
Dieser Beitrag stammt aus dem neuen Zeitpunkt-Magazins zum Thema: Das Hohelied der Landwirtschaft - hier können Sie es bestellen.
Den komplette Text von Andreas Beers veröffentlichen wir sukzessive.
Eine Kultur-Landwirtschaft ist immer ein hoch komplexer Lebensorganismus mit einer ihm eigenen, organischen Mikroökonomie, die aus sich heraus Vielfalt, Leben und Gesundheit schafft. Der Produktionsort der Landwirtschaft kann also niemals ohne langfristige Schädigung effizienter oder gar wettbewerbsfähiger gemacht werden.
Strukturwandel und Nischenproduktion sind typische Begriffe, mit denen man an der Kernaufgabe der Landwirtschaft vorbeiredet: Lama-Trekking, Besenbeizen und Vogelstrausshaltung im Hügelland, Energielandwirt, Carbon-Farming, etc. sind typische Beispiele für diesen praktizierten Wahnsinn. Es ist längst an der Zeit diesen offensichtlichen Irrtum zu beenden.
«Diese trendigen Begriffe machen es möglich, dass niemand den Verrat am bäuerlichen Kerngeschäft merken muss.»
Unsere Landwirtschaft heute – eine Bestandesaufnahme
Die konventionelle und die biologische Landwirtschaft wurden und sind weltweit durch diese industrielle Entwicklung vollständig geprägt. Sie zeigen folgenden Merkmale:
- Drastische Abnahme der Arbeitskräfte in der Urproduktion (in der Schweiz heute, nur noch ca. 1% der Bevölkerung)
- Abnehmende Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, d.h. durchschnittlich 1’000 Betriebe pro Jahr in der Schweiz
- Rückgang der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit (in der Schweiz verschwinden jedes Jahr 1’400 Hektaren Kulturfläche
- Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit
- Drastische Minimierung der Kulturpflanzenvielfalt
- Verschwinden vieler Haustierrassen
- Drastische Abnahme der Nahrungsmittelqualität.
- Zunahme von Pflanzenkrankheiten, Tierleiden, d.h. Degeneration bei allen Produktionsmitteln der Landwirtschaft.
- Die Biodiversität in Flora und Fauna schwindet drastisch
- Zunahme der Technik und des Energie- vor allem Fremdenergieverbrauchs
- Zunahme von Hilfsstoffen, welche die Umwelt, die Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen belasten und vergiften (durch Pestizide sowie Überdüngung der Böden und Kontaminierung von Fliessgewässern und Trinkwasser
- Zunehmende Betriebskosten und Verschuldung der Betriebe
- Nahrungsmittelüberfluss und Lebensmittelverschwendung
- Bodenenteignung, Hunger und Elend in der Welt
- Umweltzerstörung mit verheerenden Folgen für das Mikroklima der Erde
Landwirtschaft in der Sackgasse
«Man kann sich auf zwei Arten irren: Man kann glauben was nicht wahr ist, oder man kann sich weigern, zu glauben was wahr ist.» (Soren Kierkegaard)
Der Weg ist das Ziel und dieser neue Weg braucht seine Zeit. Zwei Jahrhunderte haben wir gebraucht, bis wir die Landwirtschaft in die heutige katastrophale Sackgasse geführt haben. Die weltweite und aktuelle Schweizer Agrarpolitik zeigt diesbezüglich hauptsächlich administrativen Aktivismus, statt konsequente Problemlösungen.
Das aktuelle Subventionssystem (Direktzahlungen) für die Schweizer Landwirtschaft fördert nach wie vor immer noch ein Agrarsystem, das unsere Umwelt stark und langfristig belastet. Aktuell werden 1 Million Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche (davon werden aktuell 15.4%, d.h. 154 000 Hektar biologisch bewirtschaftet) mit rund 3 Milliarden Franken direkt subventioniert. Dies bedeutet CHF 3 000 pro Hektar. Das gesamte Agrar-Budget der Schweiz beträgt jedoch rund 20 Milliarden Franken und finanziert hauptsächlich die industrielle Agrarwirtschaft. Inländische, industriell-wirtschaftliche Interessen und damit verbundene Finanzabhängikeiten, formen mit ihren Narrativen die Meinungsbildung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und verhindern eine für die Schweiz sinnvolle Landwirtschaftspolitik.
Gleichzeitig wird eine asoziale und umweltzerstörende Agrarpolitik weltweit vorangetrieben, durch internationale Bestrebungen und vor allem durch den europäischen, in Brüssel zentralistisch verwalteten und gesteuerten Wirtschaftsglobalismus. Eine entscheidende Rolle hierbei spielt die US-amerikanische imperialistische Aussenpolitik mit ihren Denkfabriken. Internationale Organisationen wie UNO, IWF (Internationaler Währung Fonds), IPCC (Weltklimarat) und Weltbank zeigen in diesem Zusammenhang deutlich ihre Ineffizienz, Probleme zu lösen, für die sie einst geschaffen wurden. Sie haben sich dieser imperialistischen Aussenpolitik untergeordnet und sind zu deren «Geldtasche» mutiert. Auch die Schweiz ist vollständig in diese Bestrebungen und Abhängigkeiten miteingebunden.
Was ist uns die Landwirtschaft wert?
Die Nahrungsmittelsicherheit des Landes wird immer wieder als Argument herangezogen, um damit weiterhin eine hochgradige umweltbelastende Agrarwirtschaft mit ihrem hohen Ertragspotenzial und der dazugehörigen Agrarchemie zu rechtfertigen und zu finanzieren.
Von einer autonomen Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz kann in keiner Weise gesprochen werden. Die aktuelle Schweizer Lebensmittelproduktion wird mit einem unverantwortbar hohen Fremdenergieinput betrieben (durch Übertechnisierung, Erdöl- und Stromverbrauch, Düngermittelindustrie, Pflanzenschutzmittel, Transport, usw.)
Mit unserm heutigen Konsumverhalten unterstützen wir direkt diese Form der Agrarwirtschaft. Auch die Bio-Käufer und Käuferinnen zeigen in ihrem Konsumverhalten noch sehr kuriose Irrungen: «Erdbeeren und Tomaten im Winter, Spargel im Januar aus Übersee – Mexiko und Peru, das ist birnenweich!» Solche Kaufgewohnheiten haben grundsätzlich verheerende Folgen für die Landwirtschaft in jeder Region der Welt. Sie sind unsozial, ökologisch wie auch ökonomisch völlig unsinnig. Und auch hier kann es nicht billig genug sein. Die Lebensmittelausgaben liegen beim Schweizer Konsumenten heute bei rund 6.4% seiner Lebenshaltungskosten!
Allein in der landwirtschaftlichen Produktion entstehen heute 556 000 Tonnen Lebensmittelverluste pro Jahr. Über alle Stufen der Schweizer Lebensmittelkette ergibt dies 2.8 Millionen Tonnen vermeidbare Lebensmittelverluste pro Jahr. Dies entspricht etwa 330 kg vermeidbarem Lebensmittelabfall pro Person und Jahr oder 37% der landwirtschaftlichen Produktion!
Die Kosten zur Behebung der Umweltschäden, die der Schweizer Agrarsektor nachweislich verursacht, müssen noch zu den Subventionen hinzugerechnet werden, damit wir den Unsinn dieser Sache ganz erfassen. Konkret und in Zahlen ausgedrückt lautet dies so:
Die Kosten der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Schweizer Haushalten machen über 600 CHF pro Person und Jahr aus. Dies ergibt hochgerechnet auf die gesamte Schweiz über 5 Milliarden Franken, wobei Lebensmittelverluste auf anderen Stufen der Lebensmittelkette noch nicht inbegriffen sind.
Diese vermeidbaren Lebensmittelverluste verursachen eine Gesamtumweltbelastung von knapp 1.2 Millionen Umweltbelastungspunkten (UBP) pro Person. Das entspricht 25% des Schweizer Fussabdrucks der gesamten Ernährung. Dabei ist der Umweltnutzen der Verwertung der Lebensmittelverluste bereits berücksichtigt. Dieser ist vorwiegend auf die Substitution von Futtermitteln, Elektrizität, Wärme und Dünger zurückzuführen und macht knapp 0.16 Millionen UBP pro Person aus (12% der Umweltbelastung, die bei der Produktion der verlorenen Lebensmittel entsteht).
Die Klimaeffekte der vermeidbaren Lebensmittelverluste machen knapp eine halbe Tonne CO2–Äquivalente pro Person und Jahr aus, was 24% der Klimaeffekte des ganzen Ernährungssystems der Schweiz entspricht. Auch bei den Biodiversitätseffekten sind die Lebensmittelverluste für rund ein Viertel der Effekte der ganzen Ernährung der Schweiz verantwortlich.
Das Bundesamt für Landwirtschaft weisst aktuell nachfolgende Daten zur Landwirtschaftlichen Flächennutzung auf. Diese ist eine direkte Folge unserer Agrarpolitik und ihre Subventionierungsstrategien. Beachten Sie die Flächenverhältnisse genau!
«Was dient direkt der menschlichen Ernährung»:
Landwirtschaftliche Nutzfläche gesamt: 1 042 014 Hektar (ha)
Ackerfläche gesamt: 396 599 ha
Futtergetreide für Tiere: 113 874 ha
Ackerfutter für Tiere (Kleegras): 120 005 ha
Brotgetreide: 81 602 ha
Gemüse und Feldfrüchte: 23 361 ha
Zuckerrüben: 15 647 ha
Ölsaaten: 33 295 ha
Ökologische Ausgleichsflächen: 3 061 ha
Ungenutzte Flächen: 5 476 ha
Obstbaumkulturen: 6 149 ha
Reben: 14 606 ha
Naturwiesen und Weiden (für Tiere): 605 607 ha
Streu und Torf Land: 18 974 ha
Nachwachsende Rohstoffe (ohne Wald): 357 ha
Dies ergibt folgende Auswertung:
Für die menschliche Nahrung direkt: 174 660 ha
Für die tierische Ernährung direkt: 839 486 ha
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen verringerten sich in den Jahren 2000 bis 2023 um 29 117 ha, dies bedeutet ein Verlust pro Jahr von 1 266 Hektar. Von Ernährungssicherheit kann hier beim besten Willen nicht gesprochen werden.
Natürlich ist die Tierhaltung letzten Endes auch für die menschliche Ernährung da. Hierbei muss jedoch noch folgendes beachtet werden: Zu den 839 486 Hektar inländische Fläche für die tierischen Futtermittelproduktion kommen noch rund 200 000 Hektar Futtermittel Importe aus Europa und Übersee hinzu. Die dadurch erzeugten ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen sind katastrophal! Die nachfolgende Zusammenfassung zeigt im Detail auf wie unhaltbar die Folgen der Schweizer Agrarpolitik sind. Nicht nur für die heimische Landwirtschaft und Natur, sondern vor allem für die Exportländer.
(1) Jakob Weiss, Die Schweizer Landwirtschaft stirbt leise, Orell Füssli Verlag, Zürich 2017.
Kultur-Landwirtschaft
von Andreas Beers
Inhalt
Kapitel 1: Was wir zum Leben brauchen
Kapitel 3: Die Erde, unsere Heimat
Kapitel 4: Historische Betrachtungen
Kapitel 6: Die Tierhaltung in der Landwirtschaft
Kapitel 7: Warum Kultur-Landwirtschaft
Kapitel 8: Hand anlegen – gewusst wie
Kapitel 9: Und zum Schluss - was wir tun können, jetzt sofort





