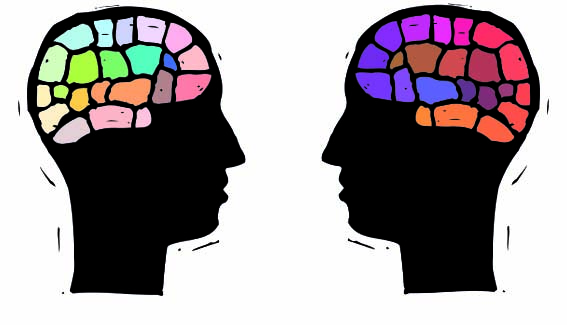Tania Singer hat nichts von einer Bewohnerin des Elfenbeinturms. Sie ist nahbar, unprätentiös, hat eine überaus lebendige Gestik und drückt sich verständlich aus. Im vorletzten Winter war sie als Rednerin zum Weltwirtschaftsforum in Davos eingeladen. Mit Humor und spürbarer Lebensfreude erklärte sie hunderten von Anzugträgern: Das dominante, auf Konkurrenz fixierte Weltbild beruht nachweislich auf Fehlannahmen über die menschliche Natur. Die Vorstellung vom allein auf seinen Vorteil bedachten homo oeconomicus sei «schlicht falsch». Nur mit «realistischeren und empirisch fundierteren Modellen» liessen sich die Probleme der Menschheit angehen. Mitstreiter in der Ökonomenzunft hat sie inzwischen gefunden: Der Leiter des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Dennis Snower erforscht Gesellschaften mit kooperativen und nachhaltigen Verhaltensweisen.
Vielleicht liegt es daran, dass sie als eineiiger Zwilling auf die Welt kam – jedenfalls ist Tania Singers Lebensthema die Frage, welche Verbindungen es zwischen den Gefühlen verschiedener Menschen gibt. Empathie, aber auch Schadenfreude, ansteckendes Lachen oder Mitgefühl sind gleichsam Spiegel von Emotionen, die zunächst ein Gegenüber erlebt. «Wie kommt eigentlich der Andere in mein Gehirn?» bringt Singer ihren Forschungsinhalt auf den Punkt. Für die studierte Psychologin sind soziale Fragen nichts Ungewöhnliches, in die Neurowissenschaften, wo ihr Vater als Professor arbeitete, war diese Perspektive dagegen Anfang des Jahrtausends noch nicht vorgedrungen. Singer wollte beide Wissenschaften verbinden und herausfinden, was bei vermittelten Gefühlen im Körper passiert. Deshalb schickte sie zunächst zahlreiche Probanden in einen Scanner und konfrontierte sie mit Schmerzschreien oder Geräuschen wimmernder Kinder. Das Ergebnis war eindeutig: Bei den Testpersonen wurden die gleichen Hirnareale aktiviert wie bei jemandem, der unmittelbar betroffen ist. Damit war auch mit harten, naturwissenschaftlichen Methoden nachgewiesen: Die Vorstellung von isolierten, nur am eigenen Wohlergehen orientierten Individuen ist nicht haltbar.
Auf einer Reise in den Himalaya kam Tania Singer in Kontakt mit buddhistischen Mönchen. Fasziniert stellte sie fest, dass es diesen Menschen offenbar gelingt, sich von Emotionen anderer nicht unmittelbar anstecken zu lassen. Vielmehr kultivieren die Mönche durch tägliche Meditation ihre Fähigkeit, sich wohlwollend und gütig dem Leiden anderer zuzuwenden. Diesem Phänomen wollte Tania Singer auf den Grund gehen, und deshalb bat sie einige Langzeitmeditierende, ihre Gehirnaktivitäten in einem Magnetresonanztomographen untersuchen zu dürfen. Zu ihrem grossen Erstaunen stellte sie fest, dass die in der Röhre liegenden Mönche auf Bilder und Geräusche leidender Kreaturen anders reagieren als ihre früheren Probanden: Bei ihnen wurden Hirnareale angesprochen, die normalerweise aktiv werden bei Belohnungen, wenn Eltern ihr Kind trösten oder jemand daran denkt, gleich ein Stück Schokolade in den Mund zu stecken. Und: Die Mönche konnten bewusst die Intensität solcher Hirnaktivitäten beeinflussen.
Zusammen mit dem Dalai Lama, Künstlern, Psychotherapeutinnen und Wissenschaftlern reflektierte Singer ihre Beobachtungen. Sie verstand, dass unwillkürliche Empathie auf anderen Grundlagen beruht als echtes Mitgefühl. Während fast alle Leute mit Ausnahme von Sadisten zusammenzucken, wenn sie sehen, wie sich jemand einen Nagel in die Hand rammt und auch Rührung oder bitteres Weinen spontan übertragen werden, geht es bei wahrhaftiger Anteilnahme um Wärme für ein bewusst wahrgenommenes Gegenüber und die Motivation, das Leiden zu lindern. Voraussetzung dafür ist die kognitive Perspektivübernahme – eine Fähigkeit, die Menschen mit Ausnahme von Autisten haben.
Empathie löst keineswegs immer den Impuls zu helfen aus, sondern ist häufig mit Überforderungsgefühlen verbunden. «Empathiestress» nennt Singer dieses Phänomen, das insbesondere bei Menschen in sozialen Berufen auftritt und manchmal im Burnout endet. Doch auch die ständige Konfrontation mit Fernsehbildern von Hungernden und Geschundenen führt häufig zu Überforderungsgefühlen: Die Ausmasse des Elends erscheinen für die Betrachter so überwältigend, die Handlungsmöglichkeiten so begrenzt, dass die empathische Resonanz bei vielen Zuschauern zu Abwehr oder sogar Aggression führt.
Sollte es nicht möglich sein, das Hirn wie einen Muskel zu trainieren und den Menschen dadurch mehr innere Freiheit zu verschaffen, wie sie auf die Emotionen anderer Menschen reagieren? fragte sich Singer. Wissenschaftler aus der Emotionsforschung haben herausgefunden, dass bestimmte Hormone und Nerven-Botenstoffe mit sozialen Einstellungen wie Vertrauen korrelieren.
Nicht die Aussicht auf den Titel als Institutsleiterin lockte Tania Singer schliesslich von ihrem Gründungslehrstuhl Soziale Neurowissenschaften und Neuroökonomie in Zürich nach Leipzig ans Max-Planck-Institut. Es war die Möglichkeit, hier ein gross angelegtes Experiment durchzuführen. Bis dahin gab es nur wenige Studien zu Wirkungsweisen von Meditation, kaum eine erfüllte wissenschaftliche Kriterien. Systematisch und umfassend wollte Singer deshalb erforschen, ob und wie bis dahin völlig Ungeübte ihre Empfindungen beeinflussen können. Gelingt es normalen Menschen durch regelmässige Meditation, das eigene Motivationssystem zu steuern?
2013 startete der einjährige Versuch unter dem Titel ReSource Project. 300 Menschen nahmen daran teil – Leute aus unterschiedlichen Berufen und Altersgruppen. Neun Monate lang dauerte das Trainingsprogramm. In der ersten Phase wurden Achtsamkeitsübungen erlernt. Einmal pro Woche traf sich die Gruppe vor Ort, in der Zwischenzeit sollte jeder täglich eine halbe Stunde lang zu Hause üben und zwischendurch immer wieder versuchen, Gerüche, Klänge, Geschmäcker oder Berührungen ganz bewusst wahrzunehmen. In den späteren Phasen ging es darum, in der Meditation sich selbst, aber auch wechselnde Partner besser verstehen und mit Wohlwollen begegnen zu können. Jede Woche arbeiteten zwei andere Probanden zusammen, erzählten sich Situationen, in denen sie schwierige Emotionen wie Trauer und Wut, aber auch Dankbarkeit erlebt hatten. Auf ähnliche Weise versuchten die Trainingspaare, ihren jeweiligen Rollenmustern wie den inneren Kritikern, Sklaventreibern, devoten Kindern oder Managern auf die Spur zu kommen und Situationen bewusst anders und zu interpretieren.
Dabei liessen sich die Teilnehmenden mehrfach untersuchen, gaben Blut ab, legten sich wiederholt in den Scanner. Im Keller des Instituts mussten sie sich in unheimlich beleuchtete Albtraumwelten voll riesiger Spinnen begeben, damit Singers Team anschliessend in ihrem Speichel den Pegel des Stressanzeigers Cortisol untersuchen konnte. Hormone, Herzfrequenzen und Hirnströme – 90 verschiedene Masse erhoben die Forschenden in regelmässigen Abständen, darüber hinaus gab es auch noch Tiefeninterviews. Trotz des immensen Zeitaufwands brach fast keiner der Teilnehmenden ab. Viele beschreiben einen Zuwachs an Autonomie, Klarheit und Wohlbefinden in zwischenmenschlichen Bereichen
Nun läuft die differenzierte Auswertung des Experiments; die Datenmengen aus den drei Vergleichsgruppen mit unterschiedlichen Programmen sind riesig. Bereits klar aber ist, dass Meditation die Reduktion von Stress sowie die bewusste Überführung von Empathie in Mitgefühl ermöglicht. Während sich viele Probanden bereits nach kurzer Zeit entspannter fühlten, zeigten sich die hormonellen Veränderungen erst nach etwa einem halben Jahr regelmässiger Praxis.
Tania Singers Ziel ist es, die Erkenntnisse in alle Bereiche der Gesellschaft einzuspeisen. Neben dem Max-Planck-Forschungsinstitut entsteht gegenwärtig eine Organisation, die Meditationslehrkräfte ausbildet und spezifische Programme für bestimmte Berufsgruppen entwickelt. Mit ihrer Hilfe sollen Pädagoginnen und Pflegekräfte, aber auch Politikerinnen und Wirtschaftslenker lernen können, ihren eigenen Gefühlen und Antriebskräften auf die Spur zu kommen, um bewusster entscheiden zu können.
«Unser Ziel muss sein, dass die Früchte dieser Praxis Allgemeingut werden, genauso üblich wie Sport in den Schulen,» meint Singer. Deshalb will sie nun auch erforschen, wie bereits Kinder Meditation erlernen können; schliesslich sind ihre Hirnströme noch viel formbarer als die der Erwachsenen. Zugleich aber weiss sie, dass viele Zeitgenossen nur durch knallharte Zahlen und Fakten zu überzeugen sind. Deshalb arbeitet sie an mathematischen Modellen über kulturelle Evolution mit. Auch die Daten in diesem Bereich sprechen dafür, dass Gesellschaften langfristig besser überleben, wenn in ihnen Kooperation und Mitgefühl zentrale Werte darstellen. Zusammengefasst: Tania Singer setzt alles daran, den homo oeconomicus als prägende Idee des 20. Jahrhunderts zur Strecke zu bringen und durch den homo cooperativus zu ersetzen.
---------------------------

Mehr zum Thema allein - zusammen finden Sie im Zeitpunkt 145 "allein - zusammen"
Vielleicht liegt es daran, dass sie als eineiiger Zwilling auf die Welt kam – jedenfalls ist Tania Singers Lebensthema die Frage, welche Verbindungen es zwischen den Gefühlen verschiedener Menschen gibt. Empathie, aber auch Schadenfreude, ansteckendes Lachen oder Mitgefühl sind gleichsam Spiegel von Emotionen, die zunächst ein Gegenüber erlebt. «Wie kommt eigentlich der Andere in mein Gehirn?» bringt Singer ihren Forschungsinhalt auf den Punkt. Für die studierte Psychologin sind soziale Fragen nichts Ungewöhnliches, in die Neurowissenschaften, wo ihr Vater als Professor arbeitete, war diese Perspektive dagegen Anfang des Jahrtausends noch nicht vorgedrungen. Singer wollte beide Wissenschaften verbinden und herausfinden, was bei vermittelten Gefühlen im Körper passiert. Deshalb schickte sie zunächst zahlreiche Probanden in einen Scanner und konfrontierte sie mit Schmerzschreien oder Geräuschen wimmernder Kinder. Das Ergebnis war eindeutig: Bei den Testpersonen wurden die gleichen Hirnareale aktiviert wie bei jemandem, der unmittelbar betroffen ist. Damit war auch mit harten, naturwissenschaftlichen Methoden nachgewiesen: Die Vorstellung von isolierten, nur am eigenen Wohlergehen orientierten Individuen ist nicht haltbar.
Auf einer Reise in den Himalaya kam Tania Singer in Kontakt mit buddhistischen Mönchen. Fasziniert stellte sie fest, dass es diesen Menschen offenbar gelingt, sich von Emotionen anderer nicht unmittelbar anstecken zu lassen. Vielmehr kultivieren die Mönche durch tägliche Meditation ihre Fähigkeit, sich wohlwollend und gütig dem Leiden anderer zuzuwenden. Diesem Phänomen wollte Tania Singer auf den Grund gehen, und deshalb bat sie einige Langzeitmeditierende, ihre Gehirnaktivitäten in einem Magnetresonanztomographen untersuchen zu dürfen. Zu ihrem grossen Erstaunen stellte sie fest, dass die in der Röhre liegenden Mönche auf Bilder und Geräusche leidender Kreaturen anders reagieren als ihre früheren Probanden: Bei ihnen wurden Hirnareale angesprochen, die normalerweise aktiv werden bei Belohnungen, wenn Eltern ihr Kind trösten oder jemand daran denkt, gleich ein Stück Schokolade in den Mund zu stecken. Und: Die Mönche konnten bewusst die Intensität solcher Hirnaktivitäten beeinflussen.
Zusammen mit dem Dalai Lama, Künstlern, Psychotherapeutinnen und Wissenschaftlern reflektierte Singer ihre Beobachtungen. Sie verstand, dass unwillkürliche Empathie auf anderen Grundlagen beruht als echtes Mitgefühl. Während fast alle Leute mit Ausnahme von Sadisten zusammenzucken, wenn sie sehen, wie sich jemand einen Nagel in die Hand rammt und auch Rührung oder bitteres Weinen spontan übertragen werden, geht es bei wahrhaftiger Anteilnahme um Wärme für ein bewusst wahrgenommenes Gegenüber und die Motivation, das Leiden zu lindern. Voraussetzung dafür ist die kognitive Perspektivübernahme – eine Fähigkeit, die Menschen mit Ausnahme von Autisten haben.
Empathie löst keineswegs immer den Impuls zu helfen aus, sondern ist häufig mit Überforderungsgefühlen verbunden. «Empathiestress» nennt Singer dieses Phänomen, das insbesondere bei Menschen in sozialen Berufen auftritt und manchmal im Burnout endet. Doch auch die ständige Konfrontation mit Fernsehbildern von Hungernden und Geschundenen führt häufig zu Überforderungsgefühlen: Die Ausmasse des Elends erscheinen für die Betrachter so überwältigend, die Handlungsmöglichkeiten so begrenzt, dass die empathische Resonanz bei vielen Zuschauern zu Abwehr oder sogar Aggression führt.
Sollte es nicht möglich sein, das Hirn wie einen Muskel zu trainieren und den Menschen dadurch mehr innere Freiheit zu verschaffen, wie sie auf die Emotionen anderer Menschen reagieren? fragte sich Singer. Wissenschaftler aus der Emotionsforschung haben herausgefunden, dass bestimmte Hormone und Nerven-Botenstoffe mit sozialen Einstellungen wie Vertrauen korrelieren.
Nicht die Aussicht auf den Titel als Institutsleiterin lockte Tania Singer schliesslich von ihrem Gründungslehrstuhl Soziale Neurowissenschaften und Neuroökonomie in Zürich nach Leipzig ans Max-Planck-Institut. Es war die Möglichkeit, hier ein gross angelegtes Experiment durchzuführen. Bis dahin gab es nur wenige Studien zu Wirkungsweisen von Meditation, kaum eine erfüllte wissenschaftliche Kriterien. Systematisch und umfassend wollte Singer deshalb erforschen, ob und wie bis dahin völlig Ungeübte ihre Empfindungen beeinflussen können. Gelingt es normalen Menschen durch regelmässige Meditation, das eigene Motivationssystem zu steuern?
2013 startete der einjährige Versuch unter dem Titel ReSource Project. 300 Menschen nahmen daran teil – Leute aus unterschiedlichen Berufen und Altersgruppen. Neun Monate lang dauerte das Trainingsprogramm. In der ersten Phase wurden Achtsamkeitsübungen erlernt. Einmal pro Woche traf sich die Gruppe vor Ort, in der Zwischenzeit sollte jeder täglich eine halbe Stunde lang zu Hause üben und zwischendurch immer wieder versuchen, Gerüche, Klänge, Geschmäcker oder Berührungen ganz bewusst wahrzunehmen. In den späteren Phasen ging es darum, in der Meditation sich selbst, aber auch wechselnde Partner besser verstehen und mit Wohlwollen begegnen zu können. Jede Woche arbeiteten zwei andere Probanden zusammen, erzählten sich Situationen, in denen sie schwierige Emotionen wie Trauer und Wut, aber auch Dankbarkeit erlebt hatten. Auf ähnliche Weise versuchten die Trainingspaare, ihren jeweiligen Rollenmustern wie den inneren Kritikern, Sklaventreibern, devoten Kindern oder Managern auf die Spur zu kommen und Situationen bewusst anders und zu interpretieren.
Dabei liessen sich die Teilnehmenden mehrfach untersuchen, gaben Blut ab, legten sich wiederholt in den Scanner. Im Keller des Instituts mussten sie sich in unheimlich beleuchtete Albtraumwelten voll riesiger Spinnen begeben, damit Singers Team anschliessend in ihrem Speichel den Pegel des Stressanzeigers Cortisol untersuchen konnte. Hormone, Herzfrequenzen und Hirnströme – 90 verschiedene Masse erhoben die Forschenden in regelmässigen Abständen, darüber hinaus gab es auch noch Tiefeninterviews. Trotz des immensen Zeitaufwands brach fast keiner der Teilnehmenden ab. Viele beschreiben einen Zuwachs an Autonomie, Klarheit und Wohlbefinden in zwischenmenschlichen Bereichen
Nun läuft die differenzierte Auswertung des Experiments; die Datenmengen aus den drei Vergleichsgruppen mit unterschiedlichen Programmen sind riesig. Bereits klar aber ist, dass Meditation die Reduktion von Stress sowie die bewusste Überführung von Empathie in Mitgefühl ermöglicht. Während sich viele Probanden bereits nach kurzer Zeit entspannter fühlten, zeigten sich die hormonellen Veränderungen erst nach etwa einem halben Jahr regelmässiger Praxis.
Tania Singers Ziel ist es, die Erkenntnisse in alle Bereiche der Gesellschaft einzuspeisen. Neben dem Max-Planck-Forschungsinstitut entsteht gegenwärtig eine Organisation, die Meditationslehrkräfte ausbildet und spezifische Programme für bestimmte Berufsgruppen entwickelt. Mit ihrer Hilfe sollen Pädagoginnen und Pflegekräfte, aber auch Politikerinnen und Wirtschaftslenker lernen können, ihren eigenen Gefühlen und Antriebskräften auf die Spur zu kommen, um bewusster entscheiden zu können.
«Unser Ziel muss sein, dass die Früchte dieser Praxis Allgemeingut werden, genauso üblich wie Sport in den Schulen,» meint Singer. Deshalb will sie nun auch erforschen, wie bereits Kinder Meditation erlernen können; schliesslich sind ihre Hirnströme noch viel formbarer als die der Erwachsenen. Zugleich aber weiss sie, dass viele Zeitgenossen nur durch knallharte Zahlen und Fakten zu überzeugen sind. Deshalb arbeitet sie an mathematischen Modellen über kulturelle Evolution mit. Auch die Daten in diesem Bereich sprechen dafür, dass Gesellschaften langfristig besser überleben, wenn in ihnen Kooperation und Mitgefühl zentrale Werte darstellen. Zusammengefasst: Tania Singer setzt alles daran, den homo oeconomicus als prägende Idee des 20. Jahrhunderts zur Strecke zu bringen und durch den homo cooperativus zu ersetzen.
---------------------------

Mehr zum Thema allein - zusammen finden Sie im Zeitpunkt 145 "allein - zusammen"