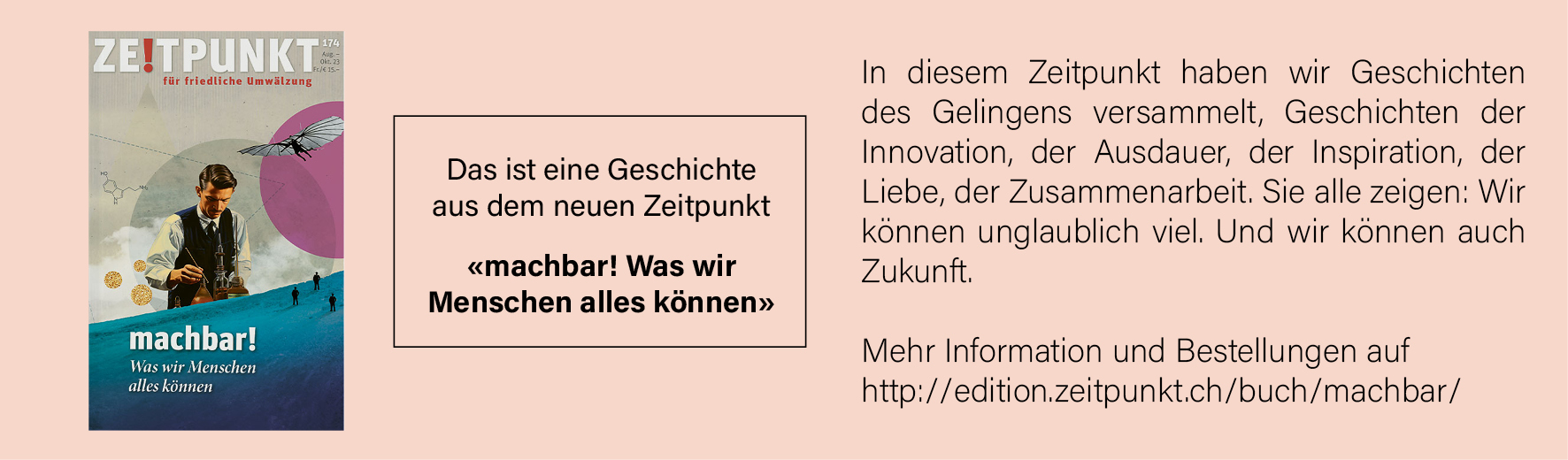
Die Kooperation von internationalen Konzernen und Regierungen in Ländern mit Bodenschätzen führt oft zu grossem Leid bei der lokalen Bevölkerung: Bergbau, Abholzung und Ölförderung hinterlassen Spuren im Ökosystem, welche Menschen und Tieren die Lebensgrundlage entziehen. Doch ab und zu kommt es auch vor, dass sich Staaten für die Umwelt und gegen die Ausbeutung einsetzen. Doch dabei werden ihnen oft Steine in den Weg gelegt – nicht zuletzt durch internationale Abkommen.
Ecuador zum Beispiel beschloss 2007, auf die Ölförderung im Yasuni-Nationalpark zu verzichten und ein Moratorium zu verhängen, das von der internationalen Gemeinschaft mitgetragen werden sollte: Die damalige Regierung bot an, die Emissionen von über 400 Millionen CO2 sowie die erwartbaren Umweltschäden zu vermeiden, indem das Öl im Boden bliebe. Dafür sollten die Industrieländer in die Pflicht genommen werden, um ihre Umweltschulden auszugleichen – und eine Zahlung an Ecuador leisten, welche die Hälfte des Gewinnes umfassen sollte, auf den das Land durch das Moratorium verzichtete. Dabei ginge es um ein Vorkommen von fast einer Milliarde Barrel Schweröl und rund 3,6 Milliarden Dollar.
Doch es kamen nicht einmal 0,5 Prozent des angestrebten Ziels zusammen, und die Schutzpläne wurden vorerst verworfen – bis zur historischen Abstimmung vor zehn Tagen, bei der das ecuatorianische Volk dafür gestimmt hat, dass alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erdölförderung schrittweise einzustellen sind und der Staat keine weiteren Konzessionen zur Erdölförderung im im Yasuní-Gebiet vergeben darf. Ein Sieg für die indigenen Gemeinschaften, die sich seit zehn Jahren für den Erhalt des Nationalparks einsetzen, und ein Rückschlag für Präsident Guillermo Lasso gewertet, der den Extraktivismus fördert.
Die Entschädigungszahlung bezog sich auf die geschätzten Gewinne, die in Zukunft hätten gemacht werden können.
Kolumbien dagegen hat 2009 das Gebiet Yaigojé Apaporis zum Nationalpark erklärt und dort den Abbau von Gold verboten. Doch das staatliche Engagement für den Umweltschutz hat sich nicht ausgezahlt, im Gegenteil. Kolumbien sah sich mit einer Schadenersatzklage in Höhe von 16,5 Milliarden Dollar konfrontiert – seitens der Konzerne «Tobie Mining and Energy» und «Cosigo Resources», deren Minenkonzessionen durch die neue Gesetzgebung ihre Gültigkeit verloren. Das Absurde daran ist, dass die geforderte Entschädigungszahlung sich nicht auf tatsächlich erlittene Verluste der Unternehmen bezog, sondern auf die geschätzten Gewinne, die sie mit ihren – noch nicht einmal existenten – Goldminen in Zukunft hätten machen können.
Möglich werden solche juristische Kunstgriffe durch Freihandelsabkommen, die so genannte Investitionsschutzstandards enthalten: Es wird zum Beispiel garantiert, dass Staaten den Investoren Schutz und Sicherheit gewähren – und Gesetzesänderungen zu Ungunsten von Konzernen können diese Klausel verletzen und können daher sanktioniert werden.
Verhandelt werden Klagen von Unternehmen gegen Staaten an so genannten Schiedsgerichten, die keine dauerhaften rechtlichen Institutionen darstellen. Sie werden im jeweiligen Fall ad hoc einberufen, und die Parteien einigen sich auf die Richter. Da die Staaten mit der Unterzeichnung der Abkommen die Kompetenz der Schiedsgerichte anerkennen, sind deren Urteile selbst vor den obersten nationalen Gerichten nicht oder nur sehr eingeschränkt anfechtbar. Damit geben Staaten einen Teil ihrer Selbstbestimmung ab und liefern sich den Forderungen von Firmen und Konzernen aus.
Durch den Widerstand der lokalen Bevölkerung wurden bereits mehrere Grossprojekte verhindert.
Allerdings gibt es auch Fälle, in denen Konzerne bei Landstreitigkeiten den Kürzeren ziehen. Zum Beispiel am brasilianischen Tapajós-Fluss, der durch das Territorium der indigenen Munduruku fliesst. Dort wurden durch den geschlossenen Widerstand der lokalen Bevölkerung bereits mehrere Grossprojekte verhindert. Beim Tapajós-Fluss handelt es sich um einen der wichtigsten Flüsse des Amazonasgebietes – und einer der letzten grossen Nebenflüsse des Amazonas, der noch nicht durch einen Staudamm zur Energiegewinnung beeinträchtigt wurde.
Das Gebiet leidet bereits unter den Folgen des illegalen Bergbaus und wird durch eine Reihe von staatlich geförderten Infrastrukturprojekten bedroht – von Holzgewinnung über Staudammprojekte bis hin zu einer Eisenbahnlinie. Die Munduruku setzen sich konsequent gegen solche Projekte und für den Schutz des Regenwaldes ein, wobei sie schon in mehr als einem Fall erfolgreich waren. Dies dürfte unter anderem der Tatsache zu verdanken sein, dass ihre Widerstandsbewegung stark geeint und gut organisiert ist.

Beim Kampf gegen ein flächenübergreifendes Staudammprojekt versammelten sich 13'000 Munduruku zum Protest – denn es sollte ein Gebiet überflutet werden, das fast doppelt so gross war wie die Stadt Wien. Mehrere Dörfer wären komplett überschwemmt worden, und hunderte von Menschen hätten umgesiedelt werden müssen. Darüber hinaus wäre mit der Umleitung der Wasserläufe und den Auswirkungen auf die umliegenden Landschaften das gesamte Ökosystem sowie die Wasserversorgung der lokalen Bevölkerung gestört worden.
Die Protestierenden blockierten Strassen und verweigerten den Landvermessern den Zugang zu ihrem Territorium. Nachdem die Sprecher von insgesamt 47 Gemeinden eine offizielle Forderung unterzeichneten, erklärte sich die Regierung mit einem Treffen einverstanden, bei dem die Argumente der Indigenen angehört wurden.
Jetzt müssen alle mithelfen.
In diesem Moment fasste Alessandra Korap Munduruku, die Präsidentin der indigenen Frauenorganisation Pariri, einen Entschluss: Obwohl sich traditionellerweise vor allem die Männer in der Widerstandsbewegung engagierten, wurde ihr bewusst: Jetzt müssen alle mithelfen. Sie organisierte die Frauen der Munduruku-Dörfer, und die soziale Bewegung erhielt ein massgebliches neues Gewicht. «Das Wasser ist uns heilig, es ist wie unsere Mutter, und wir müssen es beschützen», sagt die indigene Anführerin, die bei ihren Reden – egal ob in Gemeindeversammlungen, bei Protestmärschen oder vor nationalen Politikern – eine unwiderstehliche Überzeugungskraft ausstrahlt.
Sie tritt stets in traditioneller indigener Bemalung und Bekleidung auf, mit roten Federn geschmückt und mit aufgemalten Mustern auf Gesicht und Körper. Das ist in den Urwald-Gemeinden schon bei Kindern der Alltags-Look, doch in den Grossstädten des Landes wird man mit diesem Körperschmuck seltsam bis abschätzig angesehen. Doch Alessandra lässt sich durch nichts aufhalten, nicht einmal durch Morddrohungen. Wenn es nötig ist, haut sie auf den Tisch – und zwar wortwörtlich. Tatsächlich erlangten die Munduruku mit vereinten Kräften die Unterstützung der brasilianischen Umweltbehörde, die im August 2016 die Umweltzertifizierung des Projekts ablehnte, ohne die die Staudämme nicht gebaut werden durften.
Doch Alessandra hielt nach diesem Erfolg nicht inne. Sie und die Munduruku fochten gleich den nächsten Kampf aus: gegen den britischen Bergbaukonzern «Anglo American», dem eine Konzession für Kupferförderung gewährt werden sollte. «Die Regierung Bolsonaro öffnete dem Konzern Tür und Tor – doch uns hat niemand gefragt, ob wir einverstanden waren», erinnert sich Alessandra. «Denen ist es egal, ob wir krank werden oder sterben. Doch wir weigern uns, vertrieben zu werden oder zuzulassen, dass sie unser Land zerstören.»
Alessandra führte eine unermüdliche Kampagne gegen das Bergbauprojekt, schlug Alarm auf den Gemeindeversammlungen und holte Unterstützung bei NGOs wie der Vereinigung der indigenen Völker Brasiliens (APIB) und der internationalen Organisation Amazon Watch, die sich seit 1996 für den Schutz des Regenwaldes sowie der indigenen Völker im Amazonasgebiet einsetzt.
Wir sind wie kleine Ameisen, die immer stärker werden, je mehr sich der Bewegung anschliessen.
Gemeinsam verfassten Betroffene und Unterstützer einen offenen Brief an «Anglo American» und erreichten zudem, dass die brasilianische Regierung im Gebiet Wasserstudien durchführte und die Blutwerte der Einheimischen auswertete. Dabei wurde eine gravierende Belastung mit Quecksilber festgestellt. Die Munduruku begannen, illegale Bergbauaktivitäten mit Drohnenaufnahmen zu dokumentieren und die Grenzen ihres Territoriums mit Schildern zu markieren. Offiziell war dieses nie anerkannt worden, obwohl die Munduruku bereits seit 4000 Jahren dort leben.
Im Mai 2021 zog «Anglo American» nicht nur seine Konzessions-Anträge im Munduruku-Gebiet zurück, sondern insgesamt 26 Anträge in Gebieten, in denen es Überschneidungen mit indigenem Territorium gab. «Das war ein riesiger Erfolg», sagt Alessandra, die inzwischen Jura studiert hat, um die Rechte ihres Volkes noch besser verteidigen zu können. «Wir haben begriffen, dass wir wie kleine Ameisen sind, die immer stärker werden, je mehr sich der Bewegung anschliessen.»
Im April dieses Jahres wurde Alessandra in Anerkennung ihres langjährigen Engagements für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und der Rechte der indigenen Völker mit dem Goldman-Umweltpreis ausgezeichnet. «Mein Kampf und meine Stimme sind Teil eines kollektiven Prozesses», sagte sie, «sie existieren wegen und zusammen mit den traditionellen Leadern und anderen Frauen, die sich für unsere Rechte eingesetzt haben.»







